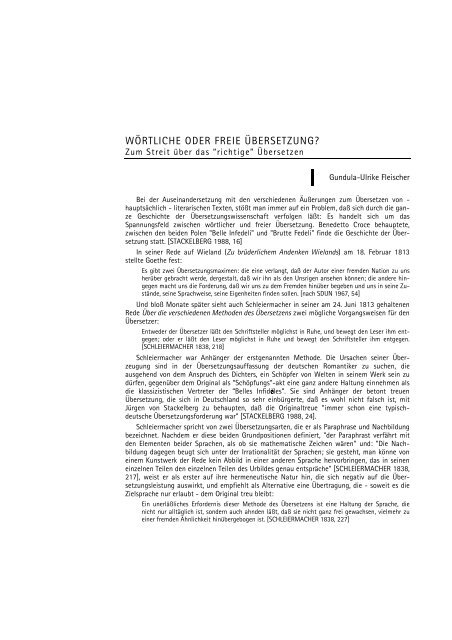NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WÖRTLICHE ODER FREIE ÜBERSETZUNG?<br />
Zum Streit über das “richtige” Übersetzen<br />
Gundula-Ulrike Fleischer<br />
Bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Äußerungen zum Übersetzen von -<br />
hauptsächlich - literarischen Texten, stößt man immer auf ein Problem, daß sich durch die ganze<br />
Geschichte der Übersetzungswissenschaft verfolgen läßt: Es handelt sich um das<br />
Spannungsfeld zwischen wörtlicher und freier Übersetzung. Benedetto Croce behauptete,<br />
zwischen den beiden Polen "Belle Infedeli" und "Brutte Fedeli" finde die Geschichte der Übersetzung<br />
statt. [STACKELBERG 1988, 16]<br />
In seiner Rede auf Wieland (Zu brüderlichem Andenken Wielands) am 18. Februar 1813<br />
stellte Goethe fest:<br />
Es gibt zwei Übersetzungsmaximen: die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Nation zu uns<br />
herüber gebracht werde, dergestalt, daß wir ihn als den Unsrigen ansehen können; die andere hingegen<br />
macht uns die Forderung, daß wir uns zu dem Fremden hinüber begeben und uns in seine Zustände,<br />
seine Sprachweise, seine Eigenheiten finden sollen. [nach SDUN 1967, 54]<br />
Und bloß Monate später sieht auch Schleiermacher in seiner am 24. Juni 1813 gehaltenen<br />
Rede Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens zwei mögliche Vorgangsweisen für den<br />
Übersetzer:<br />
Entweder der Übersetzer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen;<br />
oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen.<br />
[SCHLEIERMACHER 1838, 218]<br />
Schleiermacher war Anhänger der erstgenannten Methode. Die Ursachen seiner Überzeugung<br />
sind in der Übersetzungsauffassung der deutschen Romantiker zu suchen, die<br />
ausgehend von dem Anspruch des Dichters, ein Schöpfer von Welten in seinem Werk sein zu<br />
dürfen, gegenüber dem Original als “Schöpfungs”-akt eine ganz andere Haltung einnehmen als<br />
die klassizistischen Vertreter der “Belles Infidèles”. Sie sind Anhänger der betont treuen<br />
Übersetzung, die sich in Deutschland so sehr einbürgerte, daß es wohl nicht falsch ist, mit<br />
Jürgen von Stackelberg zu behaupten, daß die Originaltreue “immer schon eine typischdeutsche<br />
Übersetzungsforderung war” [STACKELBERG 1988, 24].<br />
Schleiermacher spricht von zwei Übersetzungsarten, die er als Paraphrase und Nachbildung<br />
bezeichnet. Nachdem er diese beiden Grundpositionen definiert, "der Paraphrast verfährt mit<br />
den Elementen beider Sprachen, als ob sie mathematische Zeichen wären" und: "Die Nachbildung<br />
dagegen beugt sich unter der Irrationalität der Sprachen; sie gesteht, man könne von<br />
einem Kunstwerk der Rede kein Abbild in einer anderen Sprache hervorbringen, das in seinen<br />
einzelnen Teilen den einzelnen Teilen des Urbildes genau entspräche" [SCHLEIERMACHER 1838,<br />
217], weist er als erster auf ihre hermeneutische Natur hin, die sich negativ auf die Übersetzungsleistung<br />
auswirkt, und empfiehlt als Alternative eine Übertragung, die - soweit es die<br />
Zielsprache nur erlaubt - dem Original treu bleibt:<br />
Ein unerläßliches Erfordernis dieser Methode des Übersetzens ist eine Haltung der Sprache, die<br />
nicht nur alltäglich ist, sondern auch ahnden läßt, daß sie nicht ganz frei gewachsen, vielmehr zu<br />
einer fremden Ähnlichkeit hinübergebogen ist. [SCHLEIERMACHER 1838, 227]