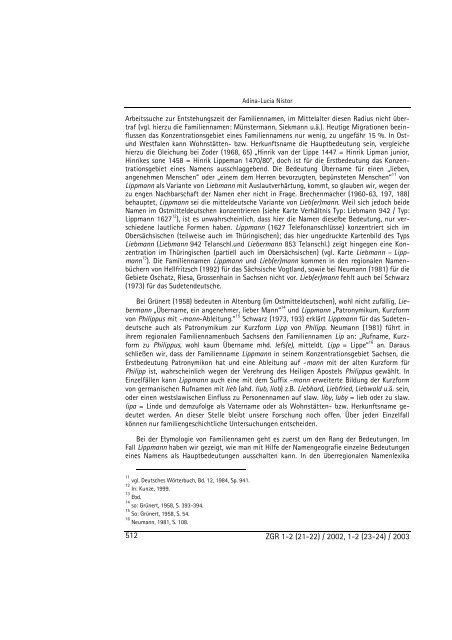NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
512<br />
Adina-Lucia Nistor<br />
Arbeitssuche zur Entstehungszeit der Familiennamen, im Mittelalter diesen Radius nicht übertraf<br />
(vgl. hierzu die Familiennamen: Münstermann, Siekmann u.ä.). Heutige Migrationen beeinflussen<br />
das Konzentrationsgebiet eines Familiennamens nur wenig, zu ungefähr 15 %. In Ost-<br />
und Westfalen kann Wohnstätten- bzw. Herkunftsname die Hauptbedeutung sein, vergleiche<br />
hierzu die Gleichung bei Zoder (1968, 65) „Hinrik van der Lippe 1447 = Hinrik Lipman junior,<br />
Hinrikes sone 1458 = Hinrik Lippeman 1470/80“, doch ist für die Erstbedeutung das Konzentrationsgebiet<br />
eines Namens ausschlaggebend. Die Bedeutung Übername für einen „lieben,<br />
angenehmen Menschen“ oder „einem dem Herren bevorzugten, begünsteten Menschen“ 11 von<br />
Lippmann als Variante von Liebmann mit Auslautverhärtung, kommt, so glauben wir, wegen der<br />
zu engen Nachbarschaft der Namen eher nicht in Frage. Brechenmacher (1960-63, 197, 188)<br />
behauptet, Lippmann sei die mitteldeutsche Variante von Lieb(er)mann. Weil sich jedoch beide<br />
Namen im Ostmitteldeutschen konzentrieren (siehe Karte Verhältnis Typ: Liebmann 942 / Typ:<br />
Lippmann 1627 12 ), ist es unwahrscheinlich, dass hier die Namen dieselbe Bedeutung, nur verschiedene<br />
lautliche Formen haben. Lippmann (1627 Telefonanschlüsse) konzentriert sich im<br />
Obersächsischen (teilweise auch im Thüringischen); das hier ungedruckte Kartenbild des Typs<br />
Liebmann (Liebmann 942 Telanschl.und Liebermann 853 Telanschl.) zeigt hingegen eine Konzentration<br />
im Thüringischen (partiell auch im Obersächsischen) (vgl. Karte Liebmann – Lippmann<br />
13 ). Die Familiennamen Lippmann und Lieb(er)mann kommen in den regionalen Namenbüchern<br />
von Hellfritzsch (1992) für das Sächsische Vogtland, sowie bei Neumann (1981) für die<br />
Gebiete Oschatz, Riesa, Grossenhain in Sachsen nicht vor. Lieb(er)mann fehlt auch bei Schwarz<br />
(1973) für das Sudetendeutsche.<br />
Bei Grünert (1958) bedeuten in Altenburg (im Ostmitteldeutschen), wohl nicht zufällig, Liebermann<br />
„Übername, ein angenehmer, lieber Mann“ 14 und Lippmann „Patronymikum, Kurzform<br />
von Philippus mit -mann-Ableitung.“ 15 Schwarz (1973, 193) erklärt Lippmann für das Sudetendeutsche<br />
auch als Patronymikum zur Kurzform Lipp von Philipp. Neumann (1981) führt in<br />
ihrem regionalen Familiennamenbuch Sachsens den Familiennamen Lip an: „Rufname, Kurzform<br />
zu Philippus, wohl kaum Übername mhd. lefs(e), mitteldt. Lipp = Lippe“ 16 an. Daraus<br />
schließen wir, dass der Familienname Lippmann in seinem Konzentrationsgebiet Sachsen, die<br />
Erstbedeutung Patronymikon hat und eine Ableitung auf -mann mit der alten Kurzform für<br />
Philipp ist, wahrscheinlich wegen der Verehrung des Heiligen Apostels Philippus gewählt. In<br />
Einzelfällen kann Lippmann auch eine mit dem Suffix -mann erweiterte Bildung der Kurzform<br />
von germanischen Rufnamen mit lieb (ahd. liub, liob) z.B. Liebhard, Liebfried, Liebwald u.ä. sein,<br />
oder einen westslawischen Einfluss zu Personennamen auf slaw. liby, luby = lieb oder zu slaw.<br />
lipa = Linde und demzufolge als Vatername oder als Wohnstätten- bzw. Herkunftsname gedeutet<br />
werden. An dieser Stelle bleibt unsere Forschung noch offen. Über jeden Einzelfall<br />
können nur familiengeschichtliche Untersuchungen entscheiden.<br />
Bei der Etymologie von Familiennamen geht es zuerst um den Rang der Bedeutungen. Im<br />
Fall Lippmann haben wir gezeigt, wie man mit Hilfe der Namengeografie einzelne Bedeutungen<br />
eines Namens als Hauptbedeutungen ausschalten kann. In den überregionalen Namenlexika<br />
11 vgl. Deutsches Wörterbuch, Bd. 12, 1984, Sp. 941.<br />
12<br />
In: Kunze, 1999.<br />
13<br />
Ebd.<br />
14<br />
so: Grünert, 1958, S. 393-394.<br />
15 So: Grünert, 1958, S. 54.<br />
16 Neumann, 1981, S. 108.<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003