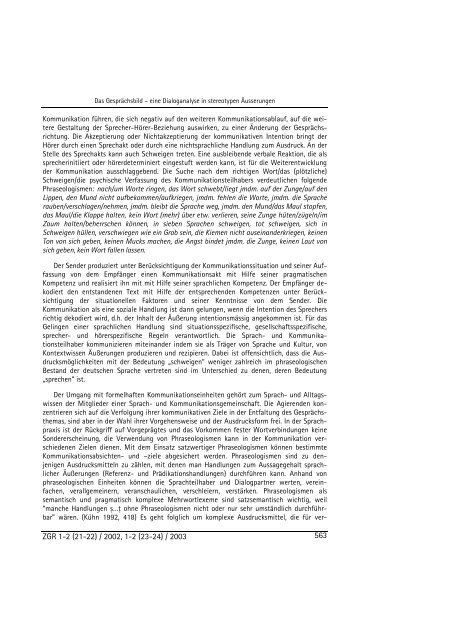NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Gesprächsbild – eine Dialoganalyse in stereotypen Äusserungen<br />
Kommunikation führen, die sich negativ auf den weiteren Kommunikationsablauf, auf die weitere<br />
Gestaltung der Sprecher-Hörer-Beziehung auswirken, zu einer Änderung der Gesprächsrichtung.<br />
Die Akzeptierung oder Nichtakzeptierung der kommunikativen Intention bringt der<br />
Hörer durch einen Sprechakt oder durch eine nichtsprachliche Handlung zum Ausdruck. An der<br />
Stelle des Sprechakts kann auch Schweigen treten. Eine ausbleibende verbale Reaktion, die als<br />
sprecherinitiiert oder hörerdeterminiert eingestuft werden kann, ist für die Weiterentwicklung<br />
der Kommunikation ausschlaggebend. Die Suche nach dem richtigen Wort/das (plötzliche)<br />
Schweigen/die psychische Verfassung des Kommunikationsteilhabers verdeutlichen folgende<br />
Phraseologismen: nach/um Worte ringen, das Wort schwebt/liegt jmdm. auf der Zunge/auf den<br />
Lippen, den Mund nicht aufbekommen/aufkriegen, jmdm. fehlen die Worte, jmdm. die Sprache<br />
rauben/verschlagen/nehmen, jmdm. bleibt die Sprache weg, jmdm. den Mund/das Maul stopfen,<br />
das Maul/die Klappe halten, kein Wort (mehr) über etw. verlieren, seine Zunge hüten/zügeln/im<br />
Zaum halten/beherrschen können, in sieben Sprachen schweigen, tot schweigen, sich in<br />
Schweigen hüllen, verschwiegen wie ein Grab sein, die Kiemen nicht auseinanderkriegen, keinen<br />
Ton von sich geben, keinen Mucks machen, die Angst bindet jmdm. die Zunge, keinen Laut von<br />
sich geben, kein Wort fallen lassen.<br />
Der Sender produziert unter Berücksichtigung der Kommunikationssituation und seiner Auffassung<br />
von dem Empfänger einen Kommunikationsakt mit Hilfe seiner pragmatischen<br />
Kompetenz und realisiert ihn mit mit Hilfe seiner sprachlichen Kompetenz. Der Empfänger dekodiert<br />
den entstandenen Text mit Hilfe der entsprechenden Kompetenzen unter Berücksichtigung<br />
der situationellen Faktoren und seiner Kenntnisse von dem Sender. Die<br />
Kommunikation als eine soziale Handlung ist dann gelungen, wenn die Intention des Sprechers<br />
richtig dekodiert wird, d.h. der Inhalt der Äußerung intentionsmässig angekommen ist. Für das<br />
Gelingen einer sprachlichen Handlung sind situationsspezifische, gesellschaftsspezifische,<br />
sprecher- und hörerspezifische Regeln verantwortlich. Die Sprach- und Kommunikationsteilhaber<br />
kommunizieren miteinander indem sie als Träger von Sprache und Kultur, von<br />
Kontextwissen Äußerungen produzieren und rezipieren. Dabei ist offensichtlich, dass die Ausdrucksmöglichkeiten<br />
mit der Bedeutung „schweigen“ weniger zahlreich im phraseologischen<br />
Bestand der deutschen Sprache vertreten sind im Unterschied zu denen, deren Bedeutung<br />
„sprechen“ ist.<br />
Der Umgang mit formelhaften Kommunikationseinheiten gehört zum Sprach- und Alltagswissen<br />
der Mitglieder einer Sprach- und Kommunikationsgemeinschaft. Die Agierenden konzentrieren<br />
sich auf die Verfolgung ihrer kommunikativen Ziele in der Entfaltung des Gesprächsthemas,<br />
sind aber in der Wahl ihrer Vorgehensweise und der Ausdrucksform frei. In der Sprachpraxis<br />
ist der Rückgriff auf Vorgeprägtes und das Vorkommen fester Wortverbindungen keine<br />
Sondererscheinung, die Verwendung von Phraseologismen kann in der Kommunikation verschiedenen<br />
Zielen dienen. Mit dem Einsatz satzwertiger Phraseologismen können bestimmte<br />
Kommunikationsabsichten- und –ziele abgesichert werden. Phraseologismen sind zu denjenigen<br />
Ausdrucksmitteln zu zählen, mit denen man Handlungen zum Aussagegehalt sprachlicher<br />
Äußerungen (Referenz- und Prädikationshandlungen) durchführen kann. Anhand von<br />
phraseologischen Einheiten können die Sprachteilhaber und Dialogpartner werten, vereinfachen,<br />
verallgemeinern, veranschaulichen, verschleiern, verstärken. Phraseologismen als<br />
semantisch und pragmatisch komplexe Mehrwortlexeme sind satzsemantisch wichtig, weil<br />
“manche Handlungen […] ohne Phraseologismen nicht oder nur sehr umständlich durchführbar”<br />
wären. (Kühn 1992, 418) Es geht folglich um komplexe Ausdrucksmittel, die für ver-<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003<br />
563