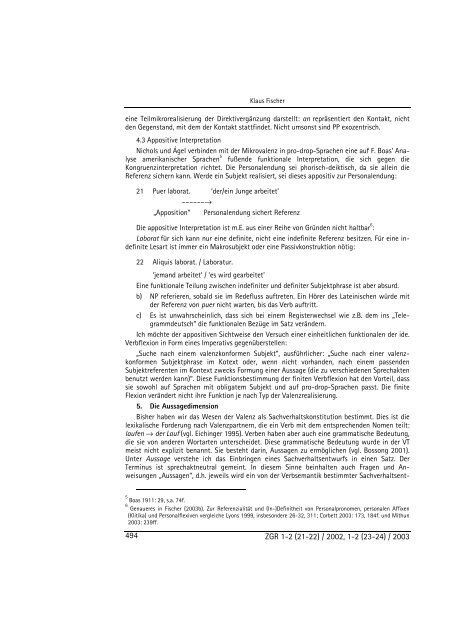NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Klaus Fischer<br />
eine Teilmikrorealisierung der Direktivergänzung darstellt: an repräsentiert den Kontakt, nicht<br />
den Gegenstand, mit dem der Kontakt stattfindet. Nicht umsonst sind PP exozentrisch.<br />
4.3 Appositive Interpretation<br />
Nichols und Ágel verbinden mit der Mikrovalenz in pro-drop-Sprachen eine auf F. Boas’ Analyse<br />
amerikanischer Sprachen 5 fußende funktionale Interpretation, die sich gegen die<br />
Kongruenzinterpretation richtet. Die Personalendung sei phorisch-deiktisch, da sie allein die<br />
Referenz sichern kann. Werde ein Subjekt realisiert, sei dieses appositiv zur Personalendung:<br />
494<br />
21 Puer laborat. ‘der/ein Junge arbeitet’<br />
––––––→<br />
„Apposition“ Personalendung sichert Referenz<br />
Die appositive Interpretation ist m.E. aus einer Reihe von Gründen nicht haltbar 6 :<br />
Laborat für sich kann nur eine definite, nicht eine indefinite Referenz besitzen. Für eine indefinite<br />
Lesart ist immer ein Makrosubjekt oder eine Passivkonstruktion nötig:<br />
22 Aliquis laborat. / Laboratur.<br />
‘jemand arbeitet’ / ‘es wird gearbeitet’<br />
Eine funktionale Teilung zwischen indefiniter und definiter Subjektphrase ist aber absurd.<br />
b) NP referieren, sobald sie im Redefluss auftreten. Ein Hörer des Lateinischen würde mit<br />
der Referenz von puer nicht warten, bis das Verb auftritt.<br />
c) Es ist unwahrscheinlich, dass sich bei einem Registerwechsel wie z.B. dem ins „Telegrammdeutsch“<br />
die funktionalen Bezüge im Satz verändern.<br />
Ich möchte der appositiven Sichtweise den Versuch einer einheitlichen funktionalen der ide.<br />
Verbflexion in Form eines Imperativs gegenüberstellen:<br />
„Suche nach einem valenzkonformen Subjekt“, ausführlicher: „Suche nach einer valenzkonformen<br />
Subjektphrase im Kotext oder, wenn nicht vorhanden, nach einem passenden<br />
Subjektreferenten im Kontext zwecks Formung einer Aussage (die zu verschiedenen Sprechakten<br />
benutzt werden kann)“. Diese Funktionsbestimmung der finiten Verbflexion hat den Vorteil, dass<br />
sie sowohl auf Sprachen mit obligatem Subjekt und auf pro-drop-Sprachen passt. Die finite<br />
Flexion verändert nicht ihre Funktion je nach Typ der Valenzrealisierung.<br />
5. Die Aussagedimension<br />
Bisher haben wir das Wesen der Valenz als Sachverhaltskonstitution bestimmt. Dies ist die<br />
lexikalische Forderung nach Valenzpartnern, die ein Verb mit dem entsprechenden Nomen teilt:<br />
laufen → der Lauf (vgl. Eichinger 1995). Verben haben aber auch eine grammatische Bedeutung,<br />
die sie von anderen Wortarten unterscheidet. Diese grammatische Bedeutung wurde in der VT<br />
meist nicht explizit benannt. Sie besteht darin, Aussagen zu ermöglichen (vgl. Bossong 2001).<br />
Unter Aussage verstehe ich das Einbringen eines Sachverhaltsentwurfs in einen Satz. Der<br />
Terminus ist sprechaktneutral gemeint. In diesem Sinne beinhalten auch Fragen und Anweisungen<br />
„Aussagen“, d.h. jeweils wird ein von der Verbsemantik bestimmter Sachverhaltsent-<br />
5 Boas 1911: 29, s.a. 74f.<br />
6 Genaueres in Fischer (2003b). Zur Referenzialität und (In-)Definitheit von Personalpronomen, personalen Affixen<br />
(Klitika) und Personalflexiven vergleiche Lyons 1999, insbesondere 26-32, 311; Corbett 2003: 173, 184f. und Mithun<br />
2003: 239ff.<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003