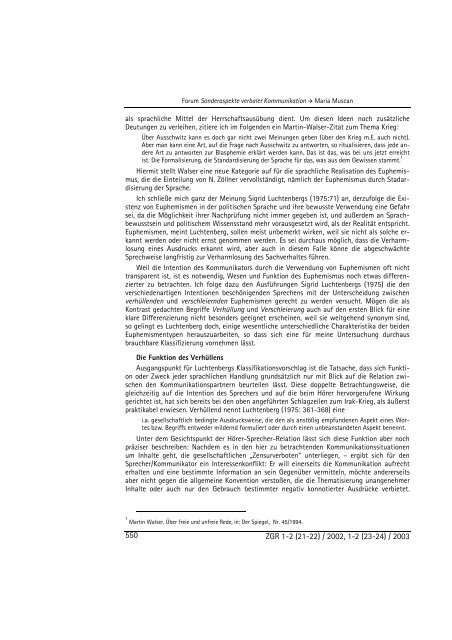NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forum Sonderaspekte verbaler Kommunikation Maria Muscan<br />
als sprachliche Mittel der Herrschaftsausübung dient. Um diesen Ideen noch zusätzliche<br />
Deutungen zu verleihen, zitiere ich im Folgenden ein Martin-Walser-Zitat zum Thema Krieg:<br />
550<br />
Über Ausschwitz kann es doch gar nicht zwei Meinungen geben (über den Krieg m.E. auch nicht).<br />
Aber man kann eine Art, auf die Frage nach Ausschwitz zu antworten, so ritualisieren, dass jede andere<br />
Art zu antworten zur Blasphemie erklärt werden kann. Das ist das, was bei uns jetzt erreicht<br />
ist. Die Formalisierung, die Standardisierung der Sprache für das, was aus dem Gewissen stammt. 1<br />
Hiermit stellt Walser eine neue Kategorie auf für die sprachliche Realisation des Euphemismus,<br />
die die Einteilung von N. Zöllner vervollständigt, nämlich der Euphemismus durch Stadardisierung<br />
der Sprache.<br />
Ich schließe mich ganz der Meinung Sigrid Luchtenbergs (1975:71) an, derzufolge die Existenz<br />
von Euphemismen in der politischen Sprache und ihre bewusste Verwendung eine Gefahr<br />
sei, da die Möglichkeit ihrer Nachprüfung nicht immer gegeben ist, und außerdem an Sprachbewusstsein<br />
und politischem Wissensstand mehr vorausgesetzt wird, als der Realität entspricht.<br />
Euphemismen, meint Luchtenberg, sollen meist unbemerkt wirken, weil sie nicht als solche erkannt<br />
werden oder nicht ernst genommen werden. Es sei durchaus möglich, dass die Verharmlosung<br />
eines Ausdrucks erkannt wird, aber auch in diesem Falle könne die abgeschwächte<br />
Sprechweise langfristig zur Verharmlosung des Sachverhaltes führen.<br />
Weil die Intention des Kommunikators durch die Verwendung von Euphemismen oft nicht<br />
transparent ist, ist es notwendig, Wesen und Funktion des Euphemismus noch etwas differenzierter<br />
zu betrachten. Ich folge dazu den Ausführungen Sigrid Luchtenbergs (1975) die den<br />
verschiedenartigen Intentionen beschönigenden Sprechens mit der Unterscheidung zwischen<br />
verhüllenden und verschleiernden Euphemismen gerecht zu werden versucht. Mögen die als<br />
Kontrast gedachten Begriffe Verhüllung und Verschleierung auch auf den ersten Blick für eine<br />
klare Differenzierung nicht besonders geeignet erscheinen, weil sie weitgehend synonym sind,<br />
so gelingt es Luchtenberg doch, einige wesentliche unterschiedliche Charakteristika der beiden<br />
Euphemismentypen herauszuarbeiten, so dass sich eine für meine Untersuchung durchaus<br />
brauchbare Klassifizierung vornehmen lässt.<br />
Die Funktion des Verhüllens<br />
Ausgangspunkt für Luchtenbergs Klassifikationsvorschlag ist die Tatsache, dass sich Funktion<br />
oder Zweck jeder sprachlichen Handlung grundsätzlich nur mit Blick auf die Relation zwischen<br />
den Kommunikationspartnern beurteilen lässt. Diese doppelte Betrachtungsweise, die<br />
gleichzeitig auf die Intention des Sprechers und auf die beim Hörer hervorgerufene Wirkung<br />
gerichtet ist, hat sich bereits bei den oben angeführten Schlagzeilen zum Irak-Krieg, als äußerst<br />
praktikabel erwiesen. Verhüllend nennt Luchtenberg (1975: 361-368) eine<br />
i.a. gesellschaftlich bedingte Ausdrucksweise, die den als anstößig empfundenen Aspekt eines Wortes<br />
bzw. Begriffs entweder mildernd formuliert oder durch einen unbeanstandeten Aspekt benennt.<br />
Unter dem Gesichtspunkt der Hörer-Sprecher-Relation lässt sich diese Funktion aber noch<br />
präziser beschreiben: Nachdem es in den hier zu betrachtenden Kommunikationssituationen<br />
um Inhalte geht, die gesellschaftlichen „Zensurverboten“ unterliegen, – ergibt sich für den<br />
Sprecher/Kommunikator ein Interessenkonflikt: Er will einerseits die Kommunikation aufrecht<br />
erhalten und eine bestimmte Information an sein Gegenüber vermitteln, möchte andererseits<br />
aber nicht gegen die allgemeine Konvention verstoßen, die die Thematisierung unangenehmer<br />
Inhalte oder auch nur den Gebrauch bestimmter negativ konnotierter Ausdrücke verbietet.<br />
1 Martin Walser. Über freie und unfreie Rede, in: Der Spiegel, Nr. 45/1994.<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003