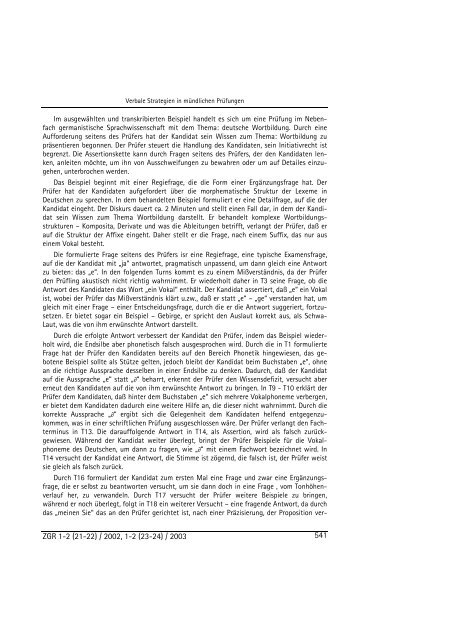NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verbale Strategien in mündlichen Prüfungen<br />
Im ausgewählten und transkribierten Beispiel handelt es sich um eine Prüfung im Nebenfach<br />
germanistische Sprachwissenschaft mit dem Thema: deutsche Wortbildung. Durch eine<br />
Aufforderung seitens des Prüfers hat der Kandidat sein Wissen zum Thema: Wortbildung zu<br />
präsentieren begonnen. Der Prüfer steuert die Handlung des Kandidaten, sein Initiativrecht ist<br />
begrenzt. Die Assertionskette kann durch Fragen seitens des Prüfers, der den Kandidaten lenken,<br />
anleiten möchte, um ihn von Ausschweifungen zu bewahren oder um auf Detailes einzugehen,<br />
unterbrochen werden.<br />
Das Beispiel beginnt mit einer Regiefrage, die die Form einer Ergänzungsfrage hat. Der<br />
Prüfer hat der Kandidaten aufgefordert über die morphematische Struktur der Lexeme in<br />
Deutschen zu sprechen. In dem behandelten Beispiel formuliert er eine Detailfrage, auf die der<br />
Kandidat eingeht. Der Diskurs dauert ca. 2 Minuten und stellt einen Fall dar, in dem der Kandidat<br />
sein Wissen zum Thema Wortbildung darstellt. Er behandelt komplexe Wortbildungsstrukturen<br />
– Komposita, Derivate und was die Ableitungen betrifft, verlangt der Prüfer, daß er<br />
auf die Struktur der Affixe eingeht. Daher stellt er die Frage, nach einem Suffix, das nur aus<br />
einem Vokal besteht.<br />
Die formulierte Frage seitens des Prüfers isr eine Regiefrage, eine typische Examensfrage,<br />
auf die der Kandidat mit „ja“ antwortet, pragmatisch unpassend, um dann gleich eine Antwort<br />
zu bieten: das „e“. In den folgenden Turns kommt es zu einem Mißverständnis, da der Prüfer<br />
den Prüfling akustisch nicht richtig wahrnimmt. Er wiederholt daher in T3 seine Frage, ob die<br />
Antwort des Kandidaten das Wort „ein Vokal“ enthält. Der Kandidat assertiert, daß „e“ ein Vokal<br />
ist, wobei der Prüfer das Mißverständnis klärt u.zw., daß er statt „e“ – „ge“ verstanden hat, um<br />
gleich mit einer Frage – einer Entscheidungsfrage, durch die er die Antwort suggeriert, fortzusetzen.<br />
Er bietet sogar ein Beispiel – Gebirge, er spricht den Auslaut korrekt aus, als Schwa-<br />
Laut, was die von ihm erwünschte Antwort darstellt.<br />
Durch die erfolgte Antwort verbessert der Kandidat den Prüfer, indem das Beispiel wiederholt<br />
wird, die Endsilbe aber phonetisch falsch ausgesprochen wird. Durch die in T1 formulierte<br />
Frage hat der Prüfer den Kandidaten bereits auf den Bereich Phonetik hingewiesen, das gebotene<br />
Beispiel sollte als Stütze gelten, jedoch bleibt der Kandidat beim Buchstaben „e“, ohne<br />
an die richtige Aussprache desselben in einer Endsilbe zu denken. Dadurch, daß der Kandidat<br />
auf die Aussprache „e“ statt „∂“ beharrt, erkennt der Prüfer den Wissensdefizit, versucht aber<br />
erneut den Kandidaten auf die von ihm erwünschte Antwort zu bringen. In T9 - T10 erklärt der<br />
Prüfer dem Kandidaten, daß hinter dem Buchstaben „e“ sich mehrere Vokalphoneme verbergen,<br />
er bietet dem Kandidaten dadurch eine weitere Hilfe an, die dieser nicht wahrnimmt. Durch die<br />
korrekte Aussprache „∂“ ergibt sich die Gelegenheit dem Kandidaten helfend entgegenzukommen,<br />
was in einer schriftlichen Prüfung ausgeschlossen wäre. Der Prüfer verlangt den Fachterminus<br />
in T13. Die darauffolgende Antwort in T14, als Assertion, wird als falsch zurückgewiesen.<br />
Während der Kandidat weiter überlegt, bringt der Prüfer Beispiele für die Vokalphoneme<br />
des Deutschen, um dann zu fragen, wie „∂“ mit einem Fachwort bezeichnet wird. In<br />
T14 versucht der Kandidat eine Antwort, die Stimme ist zögernd, die falsch ist, der Prüfer weist<br />
sie gleich als falsch zurück.<br />
Durch T16 formuliert der Kandidat zum ersten Mal eine Frage und zwar eine Ergänzungsfrage,<br />
die er selbst zu beantworten versucht, um sie dann doch in eine Frage , vom Tonhöhenverlauf<br />
her, zu verwandeln. Durch T17 versucht der Prüfer weitere Beispiele zu bringen,<br />
während er noch überlegt, folgt in T18 ein weiterer Versucht – eine fragende Antwort, da durch<br />
das „meinen Sie“ das an den Prüfer gerichtet ist, nach einer Präzisierung, der Proposition ver-<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003<br />
541