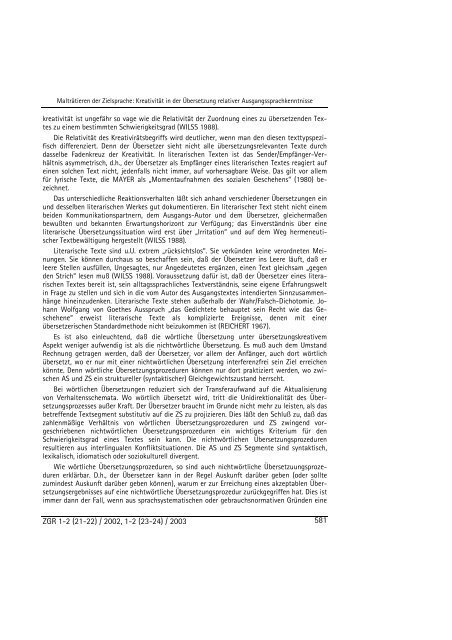NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Malträtieren der Zielsprache: Kreativität in der Übersetzung relativer Ausgangssprachkenntnisse<br />
kreativität ist ungefähr so vage wie die Relativität der Zuordnung eines zu übersetzenden Textes<br />
zu einem bestimmten Schwierigkeitsgrad (WILSS 1988).<br />
Die Relativität des Kreativirätsbegriffs wird deutlicher, wenn man den diesen texttypspezifisch<br />
differenziert. Denn der Übersetzer sieht nicht alle übersetzungsrelevanten Texte durch<br />
dasselbe Fadenkreuz der Kreativität. In literarischen Texten ist das Sender/Empfänger-Verhältnis<br />
asymmetrisch, d.h., der Übersetzer als Empfänger eines literarischen Textes reagiert auf<br />
einen solchen Text nicht, jedenfalls nicht immer, auf vorhersagbare Weise. Das gilt vor allem<br />
für lyrische Texte, die MAYER als „Momentaufnahmen des sozialen Geschehens“ (1980) bezeichnet.<br />
Das unterschiedliche Reaktionsverhalten läßt sich anhand verschiedener Übersetzungen ein<br />
und desselben literarischen Werkes gut dokumentieren. Ein literarischer Text steht nicht einem<br />
beiden Kommunikationspartnern, dem Ausgangs-Autor und dem Übersetzer, gleichermaßen<br />
bewußten und bekannten Erwartungshorizont zur Verfügung; das Einverständnis über eine<br />
literarische Übersetzungssituation wird erst über „Irritation“ und auf dem Weg hermeneutischer<br />
Textbewältigung hergestellt (WILSS 1988).<br />
Literarische Texte sind u.U. extrem „rücksichtslos“. Sie verkünden keine verordneten Meinungen.<br />
Sie können durchaus so beschaffen sein, daß der Übersetzer ins Leere läuft, daß er<br />
leere Stellen ausfüllen, Ungesagtes, nur Angedeutetes ergänzen, einen Text gleichsam „gegen<br />
den Strich“ lesen muß (WILSS 1988). Voraussetzung dafür ist, daß der Übersetzer eines literarischen<br />
Textes bereit ist, sein alltagssprachliches Textverständnis, seine eigene Erfahrungswelt<br />
in Frage zu stellen und sich in die vom Autor des Ausgangstextes intendierten Sinnzusammenhänge<br />
hineinzudenken. Literarische Texte stehen außerhalb der Wahr/Falsch-Dichotomie. Johann<br />
Wolfgang von Goethes Ausspruch „das Gedichtete behauptet sein Recht wie das Geschehene“<br />
erweist literarische Texte als komplizierte Ereignisse, denen mit einer<br />
übersetzerischen Standardmethode nicht beizukommen ist (REICHERT 1967).<br />
Es ist also einleuchtend, daß die wörtliche Übersetzung unter übersetzungskreativem<br />
Aspekt weniger aufwendig ist als die nichtwörtliche Übersetzung. Es muß auch dem Umstand<br />
Rechnung getragen werden, daß der Übersetzer, vor allem der Anfänger, auch dort wörtlich<br />
übersetzt, wo er nur mit einer nichtwörtlichen Übersetzung interferenzfrei sein Ziel erreichen<br />
könnte. Denn wörtliche Übersetzungsprozeduren können nur dort praktiziert werden, wo zwischen<br />
AS und ZS ein struktureller (syntaktischer) Gleichgewichtszustand herrscht.<br />
Bei wörtlichen Übersetzungen reduziert sich der Transferaufwand auf die Aktualisierung<br />
von Verhaltensschemata. Wo wörtlich übersetzt wird, tritt die Unidirektionalität des Übersetzungsprozesses<br />
außer Kraft. Der Übersetzer braucht im Grunde nicht mehr zu leisten, als das<br />
betreffende Textsegment substitutiv auf die ZS zu projizieren. Dies läßt den Schluß zu, daß das<br />
zahlenmäßige Verhältnis von wörtlichen Übersetzungsprozeduren und ZS zwingend vorgeschriebenen<br />
nichtwörtlichen Übersetzungsprozeduren ein wichtiges Kriterium für den<br />
Schwierigkeitsgrad eines Textes sein kann. Die nichtwörtlichen Übersetzungsprozeduren<br />
resultieren aus interlingualen Konfliktsituationen. Die AS und ZS Segmente sind syntaktisch,<br />
lexikalisch, idiomatisch oder soziokulturell divergent.<br />
Wie wörtliche Übersetzungsprozeduren, so sind auch nichtwörtliche Übersetzuungsprozeduren<br />
erklärbar. D.h., der Übersetzer kann in der Regel Auskunft darüber geben (oder sollte<br />
zumindest Auskunft darüber geben können), warum er zur Erreichung eines akzeptablen Übersetzungsergebnisses<br />
auf eine nichtwörtliche Übersetzungsprozedur zurückgegriffen hat. Dies ist<br />
immer dann der Fall, wenn aus sprachsystematischen oder gebrauchsnormativen Gründen eine<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003<br />
581