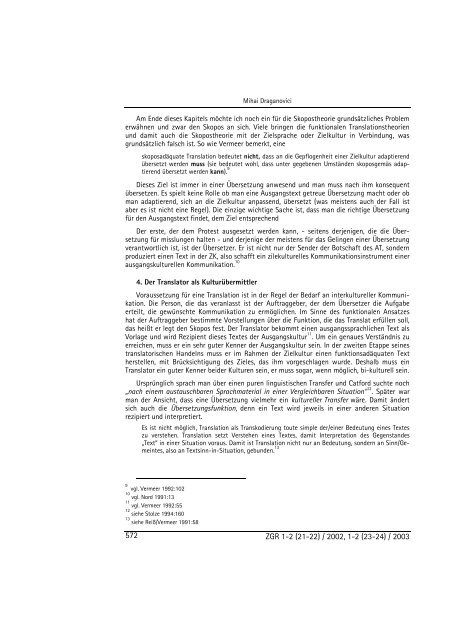NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
572<br />
Mihai Draganovici<br />
Am Ende dieses Kapitels möchte ich noch ein für die Skopostheorie grundsätzliches Problem<br />
erwähnen und zwar den Skopos an sich. Viele bringen die funktionalen Translationstheorien<br />
und damit auch die Skopostheorie mit der Zielsprache oder Zielkultur in Verbindung, was<br />
grundsätzlich falsch ist. So wie Vermeer bemerkt, eine<br />
skoposadäquate Translation bedeutet nicht, dass an die Gepflogenheit einer Zielkultur adaptierend<br />
übersetzt werden muss (sie bedeutet wohl, dass unter gegebenen Umständen skoposgemäs adaptierend<br />
übersetzt werden kann). 9<br />
Dieses Ziel ist immer in einer Übersetzung anwesend und man muss nach ihm konsequent<br />
übersetzen. Es spielt keine Rolle ob man eine Ausgangstext getreue Übersetzung macht oder ob<br />
man adaptierend, sich an die Zielkultur anpassend, übersetzt (was meistens auch der Fall ist<br />
aber es ist nicht eine Regel). Die einzige wichtige Sache ist, dass man die richtige Übersetzung<br />
für den Ausgangstext findet, dem Ziel entsprechend<br />
Der erste, der dem Protest ausgesetzt werden kann, - seitens derjenigen, die die Übersetzung<br />
für misslungen halten - und derjenige der meistens für das Gelingen einer Übersetzung<br />
verantwortlich ist, ist der Übersetzer. Er ist nicht nur der Sender der Botschaft des AT, sondern<br />
produziert einen Text in der ZK, also schafft ein zilekulturelles Kommunikationsinstrument einer<br />
ausgangskulturellen Kommunikation. 10<br />
4. Der Translator als Kulturübermittler<br />
Voraussetzung für eine Translation ist in der Regel der Bedarf an interkultureller Kommunikation.<br />
Die Person, die das veranlasst ist der Auftraggeber, der dem Übersetzer die Aufgabe<br />
erteilt, die gewünschte Kommunikation zu ermöglichen. Im Sinne des funktionalen Ansatzes<br />
hat der Auftraggeber bestimmte Vorstellungen über die Funktion, die das Translat erfüllen soll,<br />
das heißt er legt den Skopos fest. Der Translator bekommt einen ausgangssprachlichen Text als<br />
Vorlage und wird Rezipient dieses Textes der Ausgangskultur 11 . Um ein genaues Verständnis zu<br />
erreichen, muss er ein sehr guter Kenner der Ausgangskultur sein. In der zweiten Etappe seines<br />
translatorischen Handelns muss er im Rahmen der Zielkultur einen funktionsadäquaten Text<br />
herstellen, mit Brücksichtigung des Zieles, das ihm vorgeschlagen wurde. Deshalb muss ein<br />
Translator ein guter Kenner beider Kulturen sein, er muss sogar, wenn möglich, bi-kulturell sein.<br />
Ursprünglich sprach man über einen puren linguistischen Transfer und Catford suchte noch<br />
„nach einem austauschbaren Sprachmaterial in einer Vergleichbaren Situation“ 12 . Später war<br />
man der Ansicht, dass eine Übersetzung vielmehr ein kultureller Transfer wäre. Damit ändert<br />
sich auch die Übersetzungsfunktion, denn ein Text wird jeweils in einer anderen Situation<br />
rezipiert und interpretiert.<br />
Es ist nicht möglich, Translation als Transkodierung toute simple der/einer Bedeutung eines Textes<br />
zu verstehen. Translation setzt Verstehen eines Textes, damit Interpretation des Gegenstandes<br />
„Text“ in einer Situation voraus. Damit ist Translation nicht nur an Bedeutung, sondern an Sinn/Gemeintes,<br />
also an Textsinn-in-Situation, gebunden. 13<br />
9<br />
vgl. Vermeer 1992:102<br />
10<br />
vgl. Nord 1991:13<br />
11<br />
vgl. Vermeer 1992:55<br />
12<br />
siehe Stolze 1994:160<br />
13<br />
siehe Reiß/Vermeer 1991:58<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003