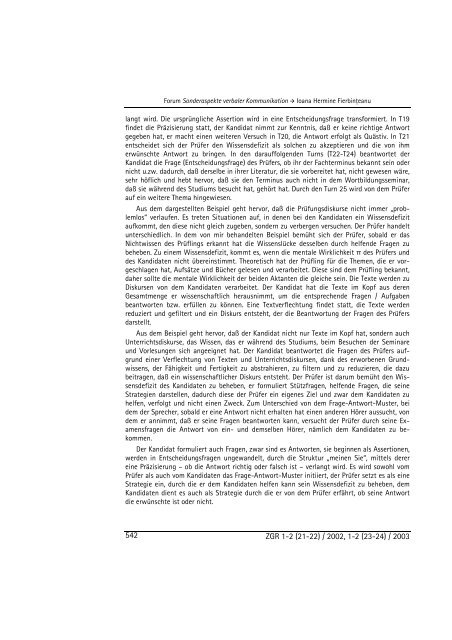NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forum Sonderaspekte verbaler Kommunikation Ioana Hermine Fierbin]eanu<br />
langt wird. Die ursprüngliche Assertion wird in eine Entscheidungsfrage transformiert. In T19<br />
findet die Präzisierung statt, der Kandidat nimmt zur Kenntnis, daß er keine richtige Antwort<br />
gegeben hat, er macht einen weiteren Versuch in T20, die Antwort erfolgt als Quästiv. In T21<br />
entscheidet sich der Prüfer den Wissensdefizit als solchen zu akzeptieren und die von ihm<br />
erwünschte Antwort zu bringen. In den darauffolgenden Turns (T22-T24) beantwortet der<br />
Kandidat die Frage (Entscheidungsfrage) des Prüfers, ob ihr der Fachterminus bekannt sein oder<br />
nicht u.zw. dadurch, daß derselbe in ihrer Literatur, die sie vorbereitet hat, nicht gewesen wäre,<br />
sehr höflich und hebt hervor, daß sie den Terminus auch nicht in dem Wortbildungsseminar,<br />
daß sie während des Studiums besucht hat, gehört hat. Durch den Turn 25 wird von dem Prüfer<br />
auf ein weitere Thema hingewiesen.<br />
Aus dem dargestellten Beispiel geht hervor, daß die Prüfungsdiskurse nicht immer „problemlos“<br />
verlaufen. Es treten Situationen auf, in denen bei den Kandidaten ein Wissensdefizit<br />
aufkommt, den diese nicht gleich zugeben, sondern zu verbergen versuchen. Der Prüfer handelt<br />
unterschiedlich. In dem von mir behandelten Beispiel bemüht sich der Prüfer, sobald er das<br />
Nichtwissen des Prüflings erkannt hat die Wissenslücke desselben durch helfende Fragen zu<br />
beheben. Zu einem Wissensdefizit, kommt es, wenn die mentale Wirklichkeit π des Prüfers und<br />
des Kandidaten nicht übereinstimmt. Theoretisch hat der Prüfling für die Themen, die er vorgeschlagen<br />
hat, Aufsätze und Bücher gelesen und verarbeitet. Diese sind dem Prüfling bekannt,<br />
daher sollte die mentale Wirklichkeit der beiden Aktanten die gleiche sein. Die Texte werden zu<br />
Diskursen von dem Kandidaten verarbeitet. Der Kandidat hat die Texte im Kopf aus deren<br />
Gesamtmenge er wissenschaftlich herausnimmt, um die entsprechende Fragen / Aufgaben<br />
beantworten bzw. erfüllen zu können. Eine Textverflechtung findet statt, die Texte werden<br />
reduziert und gefiltert und ein Diskurs entsteht, der die Beantwortung der Fragen des Prüfers<br />
darstellt.<br />
Aus dem Beispiel geht hervor, daß der Kandidat nicht nur Texte im Kopf hat, sondern auch<br />
Unterrichtsdiskurse, das Wissen, das er während des Studiums, beim Besuchen der Seminare<br />
und Vorlesungen sich angeeignet hat. Der Kandidat beantwortet die Fragen des Prüfers aufgrund<br />
einer Verflechtung von Texten und Unterrichtsdiskursen, dank des erworbenen Grundwissens,<br />
der Fähigkeit und Fertigkeit zu abstrahieren, zu filtern und zu reduzieren, die dazu<br />
beitragen, daß ein wissenschaftlicher Diskurs entsteht. Der Prüfer ist darum bemüht den Wissensdefizit<br />
des Kandidaten zu beheben, er formuliert Stützfragen, helfende Fragen, die seine<br />
Strategien darstellen, dadurch diese der Prüfer ein eigenes Ziel und zwar dem Kandidaten zu<br />
helfen, verfolgt und nicht einen Zweck. Zum Unterschied von dem Frage-Antwort-Muster, bei<br />
dem der Sprecher, sobald er eine Antwort nicht erhalten hat einen anderen Hörer aussucht, von<br />
dem er annimmt, daß er seine Fragen beantworten kann, versucht der Prüfer durch seine Examensfragen<br />
die Antwort von ein- und demselben Hörer, nämlich dem Kandidaten zu bekommen.<br />
Der Kandidat formuliert auch Fragen, zwar sind es Antworten, sie beginnen als Assertionen,<br />
werden in Entscheidungsfragen ungewandelt, durch die Struktur „meinen Sie“, mittels derer<br />
eine Präzisierung – ob die Antwort richtig oder falsch ist – verlangt wird. Es wird sowohl vom<br />
Prüfer als auch vom Kandidaten das Frage-Antwort-Muster initiiert, der Prüfer setzt es als eine<br />
Strategie ein, durch die er dem Kandidaten helfen kann sein Wissensdefizit zu beheben, dem<br />
Kandidaten dient es auch als Strategie durch die er von dem Prüfer erfährt, ob seine Antwort<br />
die erwünschte ist oder nicht.<br />
542<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003