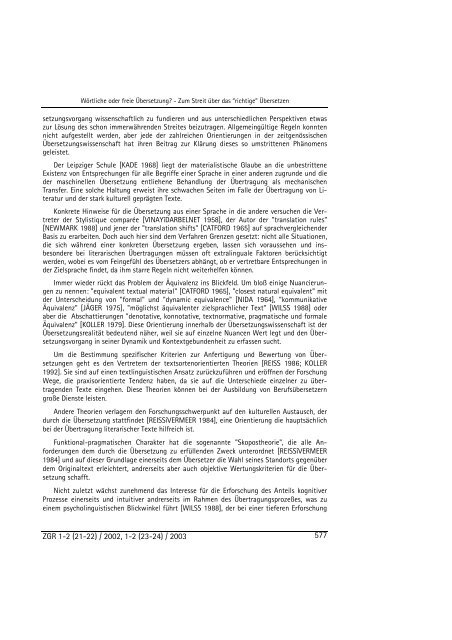NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wörtliche oder freie Übersetzung? - Zum Streit über das “richtige” Übersetzen<br />
setzungsvorgang wissenschaftlich zu fundieren und aus unterschiedlichen Perspektiven etwas<br />
zur Lösung des schon immerwährenden Streites beizutragen. Allgemeingültige Regeln konnten<br />
nicht aufgestellt werden, aber jede der zahlreichen Orientierungen in der zeitgenössischen<br />
Übersetzungswissenschaft hat ihren Beitrag zur Klärung dieses so umstrittenen Phänomens<br />
geleistet.<br />
Der Leipziger Schule [KADE 1968] liegt der materialistische Glaube an die unbestrittene<br />
Existenz von Entsprechungen für alle Begriffe einer Sprache in einer anderen zugrunde und die<br />
der maschinellen Übersetzung entliehene Behandlung der Übertragung als mechanischen<br />
Transfer. Eine solche Haltung erweist ihre schwachen Seiten im Falle der Übertragung von Literatur<br />
und der stark kulturell geprägten Texte.<br />
Konkrete Hinweise für die Übersetzung aus einer Sprache in die andere versuchen die Vertreter<br />
der Stylistique comparée [VINAY\DARBELNET 1958], der Autor der "translation rules"<br />
[NEWMARK 1988] und jener der "translation shifts" [CATFORD 1965] auf sprachvergleichender<br />
Basis zu erarbeiten. Doch auch hier sind dem Verfahren Grenzen gesetzt: nicht alle Situationen,<br />
die sich während einer konkreten Übersetzung ergeben, lassen sich voraussehen und insbesondere<br />
bei literarischen Übertragungen müssen oft extralinguale Faktoren berücksichtigt<br />
werden, wobei es vom Feingefühl des Übersetzers abhängt, ob er vertretbare Entsprechungen in<br />
der Zielsprache findet, da ihm starre Regeln nicht weiterhelfen können.<br />
Immer wieder rückt das Problem der Äquivalenz ins Blickfeld. Um bloß einige Nuancierungen<br />
zu nennen: "equivalent textual material" [CATFORD 1965], "closest natural equivalent" mit<br />
der Unterscheidung von "formal" und "dynamic equivalence" [NIDA 1964], "kommunikative<br />
Äquivalenz" [JÄGER 1975], "möglichst äquivalenter zielsprachlicher Text" [WILSS 1988] oder<br />
aber die Abschattierungen "denotative, konnotative, textnormative, pragmatische und formale<br />
Äquivalenz" [KOLLER 1979]. Diese Orientierung innerhalb der Übersetzungswissenschaft ist der<br />
Übersetzungsrealität bedeutend näher, weil sie auf einzelne Nuancen Wert legt und den Übersetzungsvorgang<br />
in seiner Dynamik und Kontextgebundenheit zu erfassen sucht.<br />
Um die Bestimmung spezifischer Kriterien zur Anfertigung und Bewertung von Übersetzungen<br />
geht es den Vertretern der textsortenorientierten Theorien [REISS 1986; KOLLER<br />
1992]. Sie sind auf einen textlinguistischen Ansatz zurückzuführen und eröffnen der Forschung<br />
Wege, die praxisorientierte Tendenz haben, da sie auf die Unterschiede einzelner zu übertragenden<br />
Texte eingehen. Diese Theorien können bei der Ausbildung von Berufsübersetzern<br />
große Dienste leisten.<br />
Andere Theorien verlagern den Forschungsschwerpunkt auf den kulturellen Austausch, der<br />
durch die Übersetzung stattfindet [REISS\VERMEER 1984], eine Orientierung die hauptsächlich<br />
bei der Übertragung literarischer Texte hilfreich ist.<br />
Funktional-pragmatischen Charakter hat die sogenannte "Skopostheorie", die alle Anforderungen<br />
dem durch die Übersetzung zu erfüllenden Zweck unterordnet [REISS\VERMEER<br />
1984] und auf dieser Grundlage einerseits dem Übersetzer die Wahl seines Standorts gegenüber<br />
dem Originaltext erleichtert, andrerseits aber auch objektive Wertungskriterien für die Übersetzung<br />
schafft.<br />
Nicht zuletzt wächst zunehmend das Interesse für die Erforschung des Anteils kognitiver<br />
Prozesse einerseits und intuitiver andrerseits im Rahmen des Übertragungsprozeßes, was zu<br />
einem psycholinguistischen Blickwinkel führt [WILSS 1988], der bei einer tieferen Erforschung<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003<br />
577