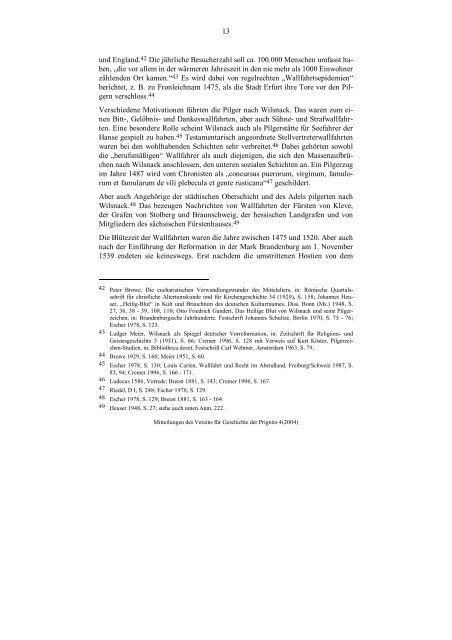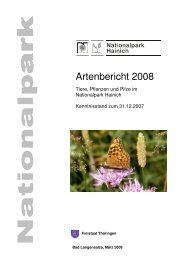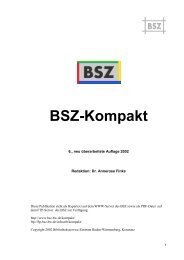Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
13<br />
und England. 42 Die jährliche Besucherzahl soll ca. 100.000 Menschen umfasst haben,<br />
„die vor allem in der wärmeren Jahreszeit in den nie mehr als 1000 Einwohner<br />
zählenden Ort kamen.“ 43 Es wird dabei von regelrechten „Wallfahrtsepidemien“<br />
berichtet, z. B. zu Fronleichnam 1475, als die Stadt Erfurt ihre Tore vor den Pilgern<br />
verschloss. 44<br />
Verschiedene Motivationen führten die Pilger nach Wilsnack. Das waren zum einen<br />
Bitt-, Gelöbnis- und Dankeswallfahrten, aber auch Sühne- und Strafwallfahrten.<br />
Eine besondere Rolle scheint Wilsnack auch als Pilgerstätte für Seefahrer der<br />
Hanse gespielt zu haben. 45 Testamentarisch angeordnete Stellvertreterwallfahrten<br />
waren bei den wohlhabenden Schichten sehr verbreitet. 46 Dabei gehörten sowohl<br />
die „berufsmäßigen“ Wallfahrer als auch diejenigen, die sich den Massenaufbrüchen<br />
nach Wilsnack anschlossen, den unteren sozialen Schichten an. Ein Pilgerzug<br />
im Jahre 1487 wird vom Chronisten als „concursus puerorum, virginum, famulorum<br />
et famularum de vili plebecula et gente rusticana“ 47 geschildert.<br />
Aber auch Angehörige der städtischen Oberschicht und des Adels pilgerten nach<br />
Wilsnack. 48 Das bezeugen Nachrichten von Wallfahrten der Fürsten von Kleve,<br />
der Grafen von Stolberg und Braunschweig, der hessischen Landgrafen und von<br />
Mitgliedern des sächsischen Fürstenhauses. 49<br />
Die Blütezeit der Wallfahrten waren die Jahre zwischen 1475 und 1520. Aber auch<br />
nach der Einführung der Re<strong>for</strong>mation in der Mark Brandenburg am 1. November<br />
1539 endeten sie keineswegs. Erst nachdem die umstrittenen Hostien von dem<br />
42 Peter Browe, Die eucharistischen Verwandlungswunder des Mittelalters, in: Römische Quartalsschrift<br />
für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte 34 (1929), S. 158; Johannes Heuser,<br />
„Heilig-Blut“ in Kult und Brauchtum des deutschen Kulturraumes, Diss. Bonn (Ms.) 1948, S.<br />
27, 36, 38 - 39, 108, 110; Otto Friedrich Gandert, Das Heilige Blut von Wilsnack und seine Pilgerzeichen,<br />
in: Brandenburgische Jahrhunderte. Festschrift Johannes Schultze, Berlin 1970, S. 75 - 76;<br />
Escher 1978, S. 123.<br />
43 Ludger Meier, Wilsnack als Spiegel deutscher Vorre<strong>for</strong>mation, in: Zeitschrift für Religions- und<br />
Geistesgeschichte 3 (1951), S. 66; Cremer 1996, S. 128 mit Verweis auf Kurt Köster, Pilgerzeichen-Studien,<br />
in: Bibliotheca docet, Festschrift Carl Wehmer, Amsterdam 1963, S. 79.<br />
44 Browe 1929, S. 160; Meier 1951, S. 60.<br />
45 Escher 1978, S. 130; Louis Carlen, Wallfahrt und Recht im Abendland, Freiburg/Schweiz 1987, S.<br />
83, 94; Cremer 1996, S. 166 - 171.<br />
46 Ludecus 1586, Vorrede; Breest 1881, S. 143; Cremer 1996, S. 167.<br />
47 Riedel, D I, S. 248; Escher 1978, S. 129.<br />
48 Escher 1978, S. 129; Breest 1881, S. 163 - 164.<br />
49 Heuser 1948, S. 27; siehe auch unten Anm. 222.<br />
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz 4(2004)