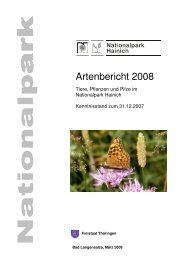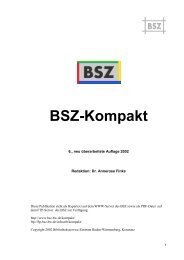Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
70<br />
setzungen körperliches Volumen. Die Szenen selbst bleiben reliefartig und beziehen<br />
ihre Tiefenräumlichkeit maßgeblich aus der Staffelung der einzelnen Figuren.<br />
Die Stendaler Abendmahlsszene könnte in der Figurenkomposition sowohl von<br />
Conrad von Soests Niederwildunger Altar (um 1414) als auch von Hans Bornemanns<br />
Heiligentaler Passionsaltar (1444 - 1447) beeinflusst sein. Letzterem entlehnt<br />
zu sein scheint die Gestalt Christi, die in der aus vier Feldern bestehenden<br />
und daher vertikal in der Mitte geteilten Glasmalerei innerhalb der Tischrunde zur<br />
Seite gerückt wurde. Der etwas unharmonische, gedrängte Eindruck entsteht, da<br />
Christus nun Johannes mit dem rechten Arm umfängt, mit dem er zugleich über<br />
den Tisch auf Judas weist.<br />
Der Rückbezug auf die westfälische Malerei des ersten Drittels des 15. Jahrhunderts<br />
bei gleichzeitiger Wirksamkeit von Vorbildern der altniederländischen Kunst<br />
ist charakteristisch für den gesamten Werkstattkomplex. Dabei weisen die Glasmalereien<br />
in mehrfacher Hinsicht Charakteristiken der westfälischen und norddeutschen<br />
Malerei des mittleren 15. Jahrhunderts auf. So belegt der Vergleich der<br />
Wilsnacker Bisch<strong>of</strong>sfiguren in Fenster nII mit der um 1450 entstandenen Nikolaustafel<br />
des Meisters von Schöppingen 261 eine nahe Verwandtschaft in der Figurenbildung,<br />
der verhaltenen Gestik sowie in Einzelmotiven wie den sehr fein mit biegsamen<br />
Fingern ausgebildeten Händen.<br />
Der nach seinem Hauptwerk, dem Passionsaltar in der Pfarrkirche von Schöppingen<br />
benannte und vermutlich in Münster oder Coesfeld ansässige Meister führte<br />
Elemente der frühniederländischen Kunst in die niederdeutsche Malerei ein. 262 Die<br />
seitlichen Szenen seines um 1450 datierten Halderner Altares erinnern in der Staffelung<br />
der in ihrem räumlichen Verhältnis zueinander erfassten, das Bildfeld mitunter<br />
fast ausfüllenden Personen an das Passionsfenster der Stendaler Jakobikirche.<br />
Auch in der Typisierung der ruhigen, meist etwas melancholisch gestimmten Figuren<br />
stehen die Glasmalereien der Auffassung des Schöppinger Meisters nahe. Gleiches<br />
gilt für die Gewänder mit den in röhrenförmigen Falten fallenden Tuniken<br />
und den bei gebrochenerer Faltenbildung ausgewischten Lichtstegen.<br />
Der Judaskuss mit dem links neben Christus stehenden Soldaten sowie Pilatus mit<br />
dem ihm von der Seite gereichten Becken ähneln entsprechenden Motiven des<br />
Halderner Altares. Die sich zum Ohr ihres Mannes neigende Frau des Pilatus wie-<br />
261 Paul Pieper, Die deutschen, niederländischen und italienischen Tafelbilder bis um 1530. Bestandskatalog<br />
Münster 1986, S. 98 - 102.<br />
262 Zum Meister von Schöppingen siehe Theodor Rensing, Der Meister von Schöppingen, Berlin 1959;<br />
Pieper 1986, S. 97 - 139.<br />
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz 4(2004)