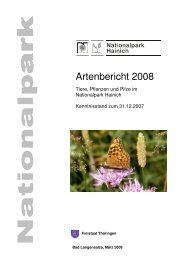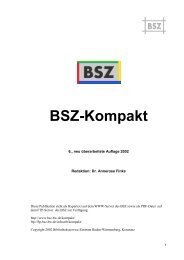Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Local Evaluation of Policies for Discounted Markov Decision Problems
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Matthias Metan<br />
Die Lenzener Holzordnung von 1746<br />
131<br />
Anmerkung der Redaktion: Nachstehend veröffentlichen wir die kurze Zusammenfassung<br />
und einen Teil des Quellenanhangs der umfangreichen <strong>for</strong>stwissenschaftlichen<br />
Diplomarbeit von Matthias Metan, die im November 2002 an der Technischen<br />
Universität Dresden verteidigt wurde und deren Titel bereits in Band 3 der<br />
„Mitteilungen“ (S. 172) angezeigt ist. Grund für diese Quellenedition ist die Tatsache,<br />
dass die Forstgeschichte bei den Historikern bisher nur wenig Beachtung gefunden<br />
hat, obwohl die Quellenlage für die Mark Brandenburg als gut zu bezeichnen<br />
ist und die Wälder stets eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung hatten.<br />
Für die Prignitz kann nur auf folgende zwei Beiträge hingewiesen werden: Paul<br />
Viereck, Wald und Forst. Die Perleberger Stadt<strong>for</strong>st im Wandel der Zeit. in: Unsere<br />
Heimat. Blätter aus der Prignitz 2 (1956), S. 99 - 107 und Heinz-Dieter Krausch,<br />
Die Wälder des Amtes Zechlin 1664 und 1721. in: Prignitz-Forschungen 2 (1971),<br />
S. 5 - 21.<br />
Zusammenfassung: Der Stadtwald von Lenzen (Elbe), der im norddeutschen Tiefland<br />
gelegen ist, veränderte sich im untersuchten Zeitraum von 1648 bis 1900 sehr<br />
stark, was vor allem durch die Stadtgeschichte und die Nutzung des zur Stadt gehörenden<br />
Naturraums bedingt ist. Entscheidend war dabei die Interessenüberlagerung<br />
der Akteure (Stadt und Administration) und die sich daraus ergebende Nutzungsüberlagerung.<br />
Die Administration war mit ihren monetären Bestrebungen auf einen<br />
möglichst hohen Reingewinn aus Holzverkäufen aus, um die Kriegsschulden der<br />
Stadt im 18. Jh. (während starker preußischer obrigkeitsstaatlicher Interventionen)<br />
abtragen zu können. Das Interesse der Bürgerschaft am Wald galt hauptsächlich<br />
seiner agrarischen Nutzung. So hat es sich zugetragen, dass die Stadt dadurch viel<br />
landwirtschaftliche Fläche (2.561 ha) gewann und hervorragende Wälder, hauptsächlich<br />
Erlen- und Eichenwälder in der Nähe von Stadt und Elbe sowie auf guten<br />
Böden, verlor. Die dann immer größer werdende Holz- und Waldnot sowie Verwüstungen<br />
(1800) bewältigte nur die geordnete und geregelte Forstwirtschaft. Sie<br />
schaffte es, auf dem flüchtigen Sand den Verhältnissen entsprechend ertragreiche<br />
Nadelwälder (738 ha) zu etablieren. In dem Zeitabschnitt bis 1886 ist der Wald<br />
durch die Leistung der Forstwirtschaft und den hohen Bedarf an Holz mit 16.292<br />
Mark pro Jahr noch die absolut größte Einnahmequelle der Stadt. Das war im Verhältnis<br />
zu den vorherigen naturnahen (weil kulturell bedingten) und außerordentlich<br />
ertragreichen Wäldern nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Bedeutung<br />
des Waldes für die Stadt war immens. Während des Dreißigjährigen Krieges gab er<br />
den letzten flüchtenden Einwohnern ein sicheres Versteck vor den marodierenden<br />
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz 4(2004)