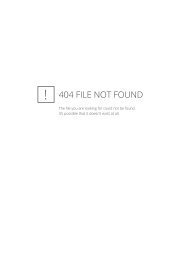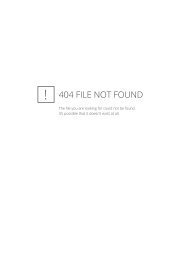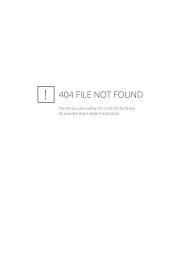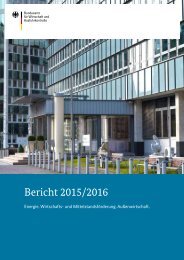Vorab-Fassung
MZ9FBD
MZ9FBD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Drucksache 18/10170 – 96 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode<br />
Gemeinden kritisieren Anbau<br />
von Energiepflanzen<br />
Immerhin 40 % der Gemeinden meinen, dass<br />
sich der Anbau negativ auf das Landschaftsbild<br />
auswirkt. Durch den Bau von Biomasseanlagen<br />
entstehen für 65 % der Gemeinden<br />
keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild,<br />
aber 30 % kritisieren solche Anlagen. K21<br />
erneuerbaren Energien durch die Verbrennung von Holzhackschnitzeln oder<br />
-pellets. Da der Bedarf an Energieholz nicht allein über die heimischen Wälder<br />
gedeckt werden kann, werden zunehmend schnellwüchsige Arten wie Pappeln<br />
und Weiden auf landwirtschaftlichen Flächen angebaut. Die sogenannten<br />
Kurzumtriebsplantagen werden alle drei bis zehn Jahre abgeholzt und sind<br />
unter bestimmten Voraussetzungen förderfähig. Mit 1.620 ha für entsprechende<br />
Plantagen nahm Brandenburg 2011 die Spitzenposition unter den Ländern ein.<br />
Die Plantagen wie auch der Anbau von Energiepflanzen wie Mais und Raps verändern<br />
das Landschaftsbild schon jetzt erheblich, auch wenn dies von den meisten<br />
in der Bevölkerung und den Gemeinden noch nicht wahrgenommen wird.<br />
Das wirtschaftliche Potenzial, das die Energiewende bietet, erkennen viele<br />
Gemeinden in ländlichen Räumen einschließlich ihrer Bevölkerung. Vielerorts<br />
werden Bürgerwindkraftanlagen in Form von Genossenschaften oder als GmbH<br />
betrieben. Die Veräußerung von Anteilen an den Windparks stößt in der Bevölkerung<br />
meist auf großes Interesse, so dass wie in der bayerischen Gemeinde<br />
Fuchstal innerhalb kürzester Zeit die Beteiligungsmöglichkeiten erschöpft<br />
sind – noch bevor die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Gemeinden können<br />
entsprechendes bürgerschaftliches Engagement durch Flächenbereitstellung<br />
oder eine Beteiligung an der Betreibergesellschaft unterstützen, wie dies in der<br />
Gemeinde Markt Taschendorf erfolgt ist. Viele Länder unterstützen die Einrichtung<br />
von Bürgerwindparks mit Publikationshilfen wie dem „Leitfaden Bürgerwindpark“,<br />
der u. a. durch die Landesregierung Schleswig-Holstein gefördert wurde.<br />
Einige Kleinstädte und Landgemeinden streben darüber hinaus mit Hilfe<br />
der eigenen Ressourcen eine Energieautarkie oder den Status eines Bioenergiedorfs<br />
an. Ziel energieautarker Gemeinden ist es, zumindest bilanziell von<br />
fossiler Energie unabhängig zu sein und stattdessen den Bedarf vollständig aus<br />
erneuerbaren Quellen zu decken. Bioenergiedörfer produzieren mindestens<br />
50 % ihres Strom- und Wärmebedarfs auf der Grundlage regional erzeugter<br />
Biomasse. Meist ist es ein Mix aus Energiegewinnung und -erzeugung der verschiedenen<br />
Energieträger Wind, Sonne und Biomasse, die hierfür im Gemeindegebiet<br />
erschlossen werden. Das schafft besondere Perspektiven vor Ort:<br />
Arbeitsplätze, langfristig bezahlbare Energiepreise und ein gemeinsames Ziel,<br />
das die Gemeinschaft unter den Einwohnern stärkt. Das Bayerische Staatsministerium<br />
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten fördert und begleitet<br />
gemeinsam mit den bayerischen Ämtern für ländliche Entwicklung die Konzepte<br />
für hundert künftig weitgehend energieneutrale Kommunen. In Baden Württemberg<br />
wurden bis 2014 mit Hilfe von EFRE-Mitteln Vorhaben für „Bioenergiedörfer“<br />
gefördert. Im Ortsteil Feldheim der brandenburgischen Stadt Treuenbrietzen<br />
gelang bereits 2010 die Energieautarkie durch die Kooperation von<br />
Privathaushalten, dem Projektentwickler und der Kommune. Für das erfolgreiche<br />
Unterfangen wurde Feldheim 2010 im ersten Bundeswettbewerb „Bioenergiedörfer“<br />
als Sieger ausgezeichnet, seitdem lobt das BMEL den Wettbewerb<br />
alle zwei Jahre aus. Die Beispiele wirken als Vorbilder: Bis 2020 werden rund<br />
420 Bioenergiedörfer und energieautarke Kommunen für Deutschland prognostiziert.<br />
Die Transformation einer Gemeinde zum Bioenergiedorf kann sozial<br />
und ökonomisch positive Auswirkungen haben, aber auch hier gilt es, multifunktional<br />
und interdisziplinär zu denken, um über die gestalterische Integration der<br />
Energieinfrastruktur hinaus einen baukulturellen Mehrwert zu erzeugen.<br />
<strong>Vorab</strong>-<strong>Fassung</strong> - wird durch lektorierte Verison ersetzt.