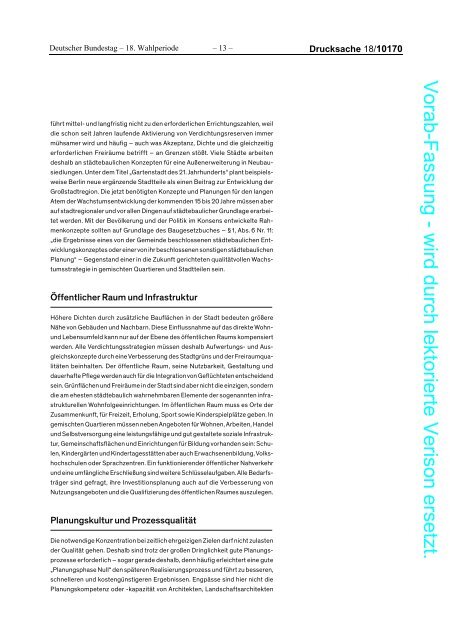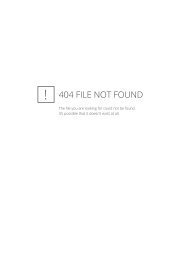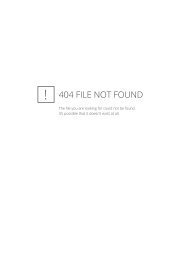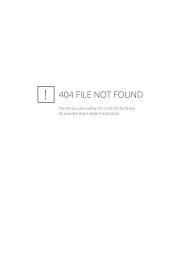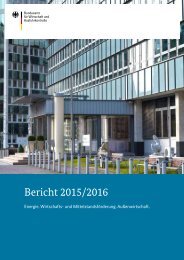Vorab-Fassung
MZ9FBD
MZ9FBD
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 13 – Drucksache 18/10170<br />
führt mittel- und langfristig nicht zu den erforderlichen Errichtungszahlen, weil<br />
die schon seit Jahren laufende Aktivierung von Verdichtungsreserven immer<br />
mühsamer wird und häufig – auch was Akzeptanz, Dichte und die gleichzeitig<br />
erforderlichen Freiräume betrifft – an Grenzen stößt. Viele Städte arbeiten<br />
deshalb an städtebaulichen Konzepten für eine Außenerweiterung in Neubausiedlungen.<br />
Unter dem Titel „Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“ plant beispielsweise<br />
Berlin neue ergänzende Stadtteile als einen Beitrag zur Entwicklung der<br />
Großstadtregion. Die jetzt benötigten Konzepte und Planungen für den langen<br />
Atem der Wachstumsentwicklung der kommenden 15 bis 20 Jahre müssen aber<br />
auf stadtregionaler und vor allen Dingen auf städtebaulicher Grundlage erarbeitet<br />
werden. Mit der Bevölkerung und der Politik im Konsens entwickelte Rahmenkonzepte<br />
sollten auf Grundlage des Baugesetzbuches – § 1, Abs. 6 Nr. 11:<br />
„die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes<br />
oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen<br />
Planung“ – Gegenstand einer in die Zukunft gerichteten qualitätvollen Wachstumsstrategie<br />
in gemischten Quartieren und Stadtteilen sein.<br />
Öffentlicher Raum und Infrastruktur<br />
Höhere Dichten durch zusätzliche Bauflächen in der Stadt bedeuten größere<br />
Nähe von Gebäuden und Nachbarn. Diese Einflussnahme auf das direkte Wohnund<br />
Lebensumfeld kann nur auf der Ebene des öffentlichen Raums kompensiert<br />
werden. Alle Verdichtungsstrategien müssen deshalb Aufwertungs- und Ausgleichskonzepte<br />
durch eine Verbesserung des Stadtgrüns und der Freiraumqualitäten<br />
beinhalten. Der öffentliche Raum, seine Nutzbarkeit, Gestaltung und<br />
dauerhafte Pflege werden auch für die Integration von Geflüchteten entscheidend<br />
sein. Grünflächen und Freiräume in der Stadt sind aber nicht die einzigen, sondern<br />
die am ehesten städtebaulich wahrnehmbaren Elemente der sogenannten infrastrukturellen<br />
Wohnfolgeeinrichtungen. Im öffentlichen Raum muss es Orte der<br />
Zusammenkunft, für Freizeit, Erholung, Sport sowie Kinderspielplätze geben. In<br />
gemischten Quartieren müssen neben Angeboten für Wohnen, Arbeiten, Handel<br />
und Selbstversorgung eine leistungsfähige und gut gestaltete soziale Infrastruktur,<br />
Gemeinschaftsflächen und Einrichtungen für Bildung vorhanden sein: Schulen,<br />
Kindergärten und Kindertagesstätten aber auch Erwachsenenbildung, Volkshochschulen<br />
oder Sprachzentren. Ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr<br />
und eine umfängliche Erschließung sind weitere Schlüsselaufgaben. Alle Bedarfsträger<br />
sind gefragt, ihre Investitionsplanung auch auf die Verbesserung von<br />
Nutzungsangeboten und die Qualifizierung des öffentlichen Raumes auszulegen.<br />
Planungskultur und Prozessqualität<br />
Die notwendige Konzentration bei zeitlich ehrgeizigen Zielen darf nicht zulasten<br />
der Qualität gehen. Deshalb sind trotz der großen Dringlichkeit gute Planungsprozesse<br />
erforderlich – sogar gerade deshalb, denn häufig erleichtert eine gute<br />
„Planungsphase Null“ den späteren Realisierungsprozess und führt zu besseren,<br />
schnelleren und kostengünstigeren Ergebnissen. Engpässe sind hier nicht die<br />
Planungskompetenz oder -kapazität von Architekten, Landschaftsarchitekten<br />
<strong>Vorab</strong>-<strong>Fassung</strong> - wird durch lektorierte Verison ersetzt.