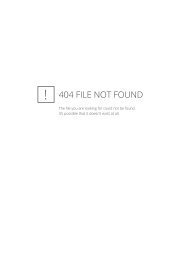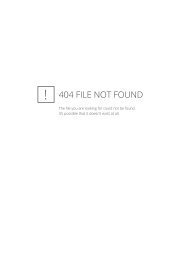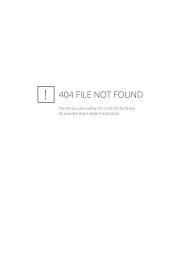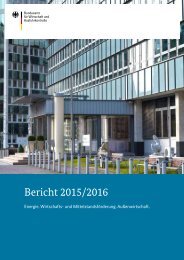Vorab-Fassung
MZ9FBD
MZ9FBD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Drucksache 18/10170 – 116 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode<br />
Planungskultur in der Politik<br />
noch nicht verankert<br />
27 % der Befragten konstatieren ein Desinteresse<br />
an „Planungskultur und Prozessqualität“<br />
bei der lokalen Politik. Diese<br />
Wahrnehmung des mangelnden Interesses<br />
von Seiten der Kommunalpolitik ist in<br />
Landgemeinden geringer ausgeprägt als<br />
bei den anderen Gemeindegrößen. K28<br />
Zusammen mit den Nachbarn<br />
Knapp 43 % aller Kommunen bestätigen<br />
eine interkommunale Zusammenarbeit mit<br />
ihren Nachbargemeinden bei Bau- und<br />
Planungsaufgaben. Dabei erfolgt eine Zusammenarbeit<br />
in 48 % der Landgemeinden, in<br />
37 % der Kleinstädte und in 46 % der Mittelstädte.<br />
K5<br />
Baukultur als Handlungsebene der öffentlichen Planung<br />
Bezeichnend für kleine Städte und Gemeinden ist vor allem die große „Nähe“<br />
innerhalb der Kommunalverwaltung sowie zwischen Verwaltung und Bevölkerung<br />
– „man kennt sich“. Abstimmungen können direkter erfolgen und das lokale<br />
Engagement berücksichtigen. Abhängig von den persönlichen Interessen der<br />
Entscheidungsträger können bei einem fehlenden Verständnis für Baukultur der<br />
Prozess und die Umsetzung eines Projektes aber auch erschwert werden. Je<br />
kleiner die Kommune, desto größer sind in der Regel zumindest die Chancen,<br />
die sich aus den lokalen Strukturen ergeben. Gerade die – haupt- oder ehrenamtlichen<br />
– Bürgermeister haben als zentrale Akteure für baukulturelle Prozesse<br />
Einflussmöglichkeit auf die lokale Baukultur. Zwar unterscheiden sich die Amtsperioden<br />
je nach Gemeindeordnung der Bundesländer, aber vielerorts ist die<br />
Amtszeit des Bürgermeisters länger als die des Gemeinderats – im Saarland<br />
reicht sie bis zu zehn Jahren. Daraus ergibt sich eine große Chance für die Kontinuität<br />
und Dauerhaftigkeit baukultureller Prozesse in den Gemeinden. Von<br />
zentraler Bedeutung ist, dass die Kommune ihre Rolle aktiv ausfüllt und ihre<br />
Planungshoheit sowie die Regeln, Möglichkeiten und Chancen des Baurechts<br />
nicht nur ernst nimmt, sondern vor allem verantwortungsbewusst umsetzt –<br />
kommunale Selbstverwaltung ist nicht nur Recht, sondern im Sinne der Gemeinwohlorientierung<br />
und Daseinsvorsorge auch Pflicht zur Gestaltung eines lebenswerten<br />
Ortes.<br />
Kommunalpolitik und Verwaltungsspitze als Treiber Wichtige Akteure<br />
bei der Einführung von Baukultur in die öffentliche Planung sind die Kommunalpolitik<br />
– die lokalen Gemeinderäte oder -vertreter – und die jeweilige Verwaltungsspitze.<br />
Im Idealfall werden Gemeindeentwicklungs- oder Dorferneuerungsprozesse<br />
durch die Politik angestoßen und zusätzlich zur „Chefsache“<br />
erklärt. Solche Prozesse bilden das „Dach“ für alle weiteren Handlungsansätze.<br />
Baukultur wird so zum integralen Bestandteil der Gemeindeentwicklung mit<br />
dem Ziel, ein Bewusstsein für den Mehrwert von ortsgerechter Gestaltung zu<br />
schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der interkommunalen Kooperation,<br />
der ausgewogenen Berücksichtigung aller Ortsteile und transparenter<br />
Partizipationsprozesse für die Öffentlichkeit. Die Erfahrungen der kommunalen<br />
Realität zeigen jedoch, dass vor allem die interkommunale Kooperation vor dem<br />
Hintergrund eines „Kirchturmdenkens“ vielerorts eine Herausforderung darstellt:<br />
Zusammenarbeit findet bei eher „weichen“ Themen wie Tourismusentwicklung<br />
oder einem gemeinsamen Radwegenetz meist problemlos statt, bei konkreten<br />
baulichen Themen hingegen seltener. Interkommunales Handeln bedarf oft erst<br />
eines gewissen „Leidensdrucks“, beispielsweise wenn Problemlagen nicht mehr<br />
auf kommunaler Ebene bewältigt werden können oder die Grenzen kommunalen<br />
Agierens erreicht sind. Beispiele wie die „Interkommunale Allianz Oberes<br />
Werntal“ – ein Zusammenschluss von zehn bayerischen Gemeinden – zeigen<br />
jedoch, dass eine gemeindeübergreifende Betrachtung der Flächen- und Gebäudepotenziale<br />
auch das schwierige Ziel „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“<br />
erfolgreich anpacken kann.<br />
Auch innerhalb der Gemeinde sind offene Kommunikationsstrukturen und<br />
ein Interessenausgleich zwischen Ortsteilen notwendig. Denn in ländlichen<br />
Räumen umfassen die Verwaltungseinheiten meist mehrere, räumlich vonein-<br />
<strong>Vorab</strong>-<strong>Fassung</strong> - wird durch lektorierte Verison ersetzt.