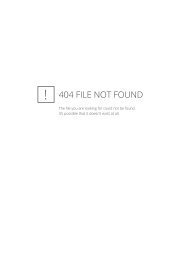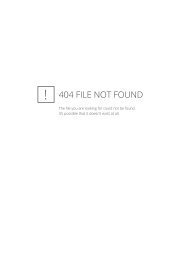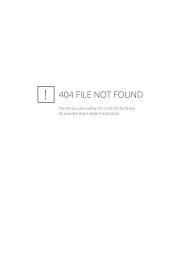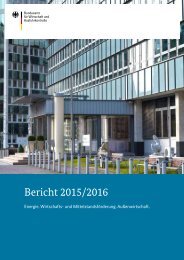Vorab-Fassung
MZ9FBD
MZ9FBD
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Drucksache 18/10170 – 102 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode<br />
Wachstum braucht Freiräume<br />
37 % der Gemeinden halten die Gestaltung<br />
öffentlicher Räume für eine wichtige Aufgabe<br />
im Bereich Planen und Bauen. Die Bedeutung<br />
des Themas steigt mit den Bevölkerungszahlen:<br />
So messen 54 % der Mittelstädte und<br />
in erster Linie stark wachsende Städte dieser<br />
Aufgabe besondere Bedeutung bei. K2<br />
Unzufriedenheit mit Freiräumen<br />
bei den Jungen<br />
Mit 73 % ist die Mehrheit der Befragten<br />
zufrieden mit den Grünflächen und Naherholungsmöglichkeiten<br />
in der eigenen Gemeinde.<br />
Kritik kommt am ehesten von der jüngeren<br />
Generation der 18- bis 29-Jährigen mit 36 %<br />
Unzufriedenheit. B7<br />
Außenfassaden ausschließlich mit Putz oder Holz zulässig ist. Zur Förderung<br />
und Würdigung der Holzbauweise wird alle zwei Jahre der „Deutsche Holzbaupreis“<br />
vergeben, seit 2003 mit Unterstützung durch die Deutsche Bundestiftung<br />
Umwelt (DBU). 2015 zählte u. a. der Neubau eines Kultur- und Kongressforums<br />
in der 13.000 Einwohner zählenden bayerischen Kreisstadt Altötting<br />
zu den Preisträgern, der gestalterisch und in der Tragwerksplanung neue Wege<br />
im Holzbau beschreitet. Gleichermaßen werden Umbauten im Bestand gewürdigt.<br />
Bei dem Umbau eines Bauernhauses in der rund 700 Einwohner zählenden<br />
bayerischen Gemeinde Philippsreut kommt der Baustoff nicht nur zum<br />
Einsatz, um sich gut in das Ortsbild einzugliedern, sondern ebenso, um moderne<br />
Brüche in der Gestaltung deutlich zu akzentuieren. Die Holzbauweise ist aber<br />
nicht nur ländlichen Räumen vorbehalten: In den wettbewerbsbegleitenden<br />
Publikationen zeigt sich, das die Preisträger auf das gesamte Bundesgebiet<br />
verteilt sind und keinen Schwerpunkt bei den Gemeindegrößen erkennen<br />
lassen. Klimagerechtes Bauen ist wesentlich durch die Verwendung lokaler<br />
Baustoffe gekennzeichnet. Weitere wichtige Aspekte für die Anpassung der<br />
Siedlungsstruktur an den Klimawandel sind u. a. die Fassaden- und Dachbegrünung,<br />
die Kompaktheit der Baukörper oder auch Verschattungselemente<br />
an den Fassaden.<br />
Klimaschonendes Flächenmanagement Bäume und Grünflächen leisten<br />
einen wichtigen Beitrag für ein gesundes Mikroklima im Siedlungsgefüge. Im<br />
Zuge des Klimawandels wird erwartet, dass der Bedarf an schattenspendenden<br />
Bäumen für Abkühlung weiter steigen wird. Straßenbegleitendes Grün, neue<br />
Parkanlagen auf Konversionsflächen, die gezielte Erweiterung bzw. Verbindung<br />
vorhandener Grün- und Freiflächen mit dem Umland und das Ausweisen von<br />
Biotopverbundflächen auch über Gemeindegrenzen hinweg sind wichtige Anpassungsmaßnahmen<br />
von Städten und Gemeinden an den Klimawandel, die gleichzeitig<br />
der baukulturellen Aufwertung dienen. Was aus klimatischer Sicht ohnehin<br />
erforderlich ist, bringt für die Gestaltung des öffentlichen Raums und das soziale<br />
Miteinander in der Gemeinde wichtige Synergien mit sich. Entsprechend weist<br />
die knapp 5.000 Einwohner zählende Gemeinde Hartmannsdorf in Sachsen auf<br />
ihrer Internetseite darauf hin, dass die Verwendung von heimischen und standortgerechten<br />
Gehölzen, der Erhalt und die Pflege alter Obstsorten und die bauliche<br />
Ergänzung durch ortstypische Zäune, Mauern und Treppen von besonderer<br />
Bedeutung nicht zuletzt für das Ortsbild sind.<br />
Wie widerstandsfähig und resilient die Strukturen einer Gemeinde sind,<br />
hängt zudem stark vom Flächenverbrauch und dem Versiegelungsgrad im<br />
Gemeindegebiet ab. Sich auf die bauliche Mitte in der Gemeinde zu konzentrieren,<br />
kommt also nicht nur der Belebung der Ortskerne zugute, sondern vermeidet<br />
unnötige Eingriffe in Natur und Landschaft. Viele Gemeinden verfolgen<br />
bereits das Ziel Innen- vor Außenentwicklung. Besonders vorbildlich ging das<br />
Land Baden-Württemberg in diesem Zusammenhang vor: Während der fünfjährigen<br />
Laufzeit des Modellprojekts MELAP zur „Eindämmung des Landschaftsverbrauchs<br />
durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials“ wurde den 13 beteiligten<br />
Gemeinden – allesamt mit deutlich weniger als 5.000 Einwohnern – der<br />
Verzicht auf Außenentwicklung auferlegt. Diese Auflage wurde erfolgreich erfüllt.<br />
Die kritische Überprüfung des tatsächlichen Bedarfs an Bauland hat in den<br />
Gemeinden dazu geführt, dass auf insgesamt 38,8 ha Neuinanspruchnahme –<br />
<strong>Vorab</strong>-<strong>Fassung</strong> - wird durch lektorierte Verison ersetzt.