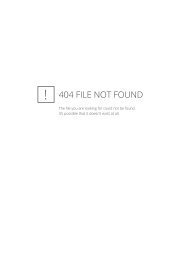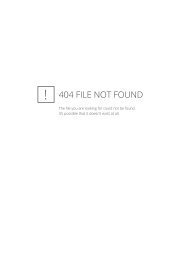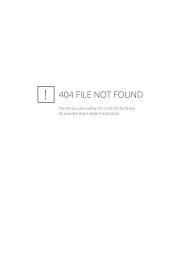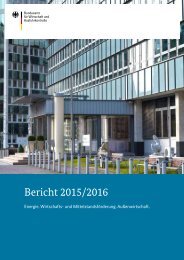Vorab-Fassung
MZ9FBD
MZ9FBD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 129 – Drucksache 18/10170<br />
Stadtumbaus als Partner der Kommune einbringt. Im hessischen Witzenhausen<br />
beschäftigt sich der „Bürgerverein zur Förderung der Bau- und Wohnkultur“ mit<br />
den Herausforderungen des demografischen Wandels für die Zivilgesellschaft,<br />
während das Projekt „Potemkinsches Dorf Gottsbüren“ ebenfalls in Hessen<br />
versucht, unter Einsatz künstlerischer Mittel neue Ideen für das schrumpfende<br />
Dorf zu befördern.<br />
Auch Bund und Länder spielen eine verantwortungsvolle Rolle bei der Verankerung<br />
von Beteiligungsformaten in den Gemeinden. So hat das Land Baden-<br />
Württemberg Bürgerbeteiligung zur Voraussetzung für die Fördermittelvergabe<br />
gemacht: Um auch oft schwierig zu aktivierende Bevölkerungsgruppen zu erreichen,<br />
wurde hier bis 2014 die Einrichtung von „BürgerInnenRäten“ als Instrument<br />
der Politikberatung auf kommunaler Ebene gefördert. Einen solchen BürgerInnenRat<br />
hat die baden-württembergische Gemeinde Steinach im Kinzigtal als<br />
begleitendes Instrument in einem workshop-basierten Gemeindeentwicklungsprozess<br />
eingesetzt. Zur Einberufung des Rates wurde jede 20. Person aus dem<br />
Einwohnermelderegister angeschrieben, so dass er sich aus einer zufälligen<br />
Auswahl von Bürgern ab 16 Jahren zusammensetzt und damit einen Querschnitt<br />
abbildet. Der BürgerInnenRat entwickelt Ideen und Vorschläge für anstehende<br />
Planungsaufgaben und kann jährlich zu wechselnden Themen einberufen werden.<br />
Ein ähnliches Modell verfolgt auch das Land Vorarlberg in Österreich mit<br />
seinen „Bürgerräten“, allerdings mit einer noch höheren Verbindlichkeit, da die<br />
partizipative Demokratie 2013 in die Landesverfassung aufgenommen wurde<br />
und die Bürgerbeteiligung so an Bedeutung gewonnen hat.<br />
Fazit: Gemeinsame Planung als Chance<br />
In kleinen und mittleren Kommunen geht es oft um eine (Re-)Aktivierung und<br />
Belebung des Gemeinschaftslebens, Baukultur kann dafür ein guter Motor sein.<br />
Den Gemeinden kommt die Aufgabe zu, selbst baukulturell Vorbild zu sein und<br />
möglichst viele Zuständigkeitsbereiche, Disziplinen und Bevölkerungsgruppen<br />
dafür zu gewinnen, an einer Qualifizierung der gebauten Umwelt mitzuwirken.<br />
Es ist ein Zeichen von Baukultur, von Planungs- und Prozessqualität, wenn alle<br />
hierfür zur Verfügung stehenden Instrumente gemeinsam eingesetzt werden.<br />
Kompetenz stärken, zusammenarbeiten und voneinander lernen In<br />
den Kommunen, vor allem aber in Gemeinden, die von Schrumpfung, Deindustrialisierung<br />
oder vergleichbaren einschneidenden Entwicklungen betroffen<br />
sind, bietet der offensive und transparente Umgang mit den Problemen Chancen<br />
zur Reaktivierung der Gemeinschaft. Daher ist es für die Stabilisierung der<br />
Gemeinden wichtig, frühzeitig in einer „Phase Null“ konzeptionelle Überlegungen<br />
zum Umgang mit bevorstehenden Herausforderungen und Aufgabenstellungen<br />
anzustellen und zu kommunizieren. Dies kann im Rahmen der Aufstellung<br />
von Entwicklungskonzepten auf Quartiers-, Stadtteil-, gesamtstädtischer<br />
oder gemeindeübergreifender Ebene geschehen, aber auch im Kontext von<br />
Förderprogrammen oder (Groß-)Ereignissen wie Regionalen und Bauausstellungen<br />
unterstützt werden. Kommunales Ziel sollte dabei immer sein, wieder<br />
in eine Position des „Agierens“ zu gelangen, statt nur noch auf Entwicklungen<br />
zu „reagieren“. Eine aktive Rolle ist auch wichtig für die Zusammenarbeit mit<br />
<strong>Vorab</strong>-<strong>Fassung</strong> - wird durch lektorierte Verison ersetzt.