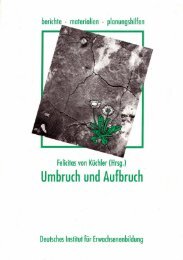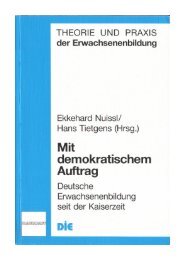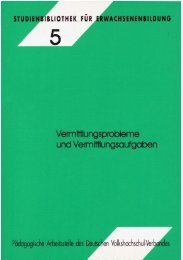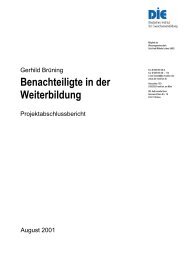Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zungen zu den biologistischen Vorstellungen<br />
der nationalsozialistischen Ideen schwer.<br />
Geesche Dannemann resümiert ihre Untersuchung:<br />
„Das tragische Element im Leben Bertha<br />
Ramsauers kommt darin zum Ausdruck, daß<br />
sie zwar ,ihr‘ Heim über die Zeit des Nationalsozialismus<br />
retten konnte, diese Rettung aber<br />
nur durch eine tiefe Verstrickung in nationalsozialistische<br />
Strukturen möglich war. Dies hatte<br />
zur Folge, daß nach 1945 ein Weiterbestehen<br />
des Heims bzw. ein Neuanfang schon aufgrund<br />
des Widerspruchs der Militärregierung<br />
nicht möglich war. Der Tod Bertha Ramsauers<br />
und der Umstand, daß sich auch später keine<br />
neue Leiterin finden ließ, verhinderten eine<br />
Wiederaufnahme der Bildungsarbeit in<br />
Husbäke“ (S. 88f.).<br />
Birgit Meyer-Ehlert hat in einer standardisierten<br />
Befragungsaktion 521 Weiterbildungseinrichtungen<br />
in Nordrhein-Westfalen nach der<br />
Situation der bei ihnen beschäftigten Frauen<br />
befragt. Sie unterscheidet dabei Volkshochschulen,<br />
Träger der politischen Bildung, „andere“<br />
Träger wie Familienbildungsstätten, Akademien,<br />
Heimvolkshochschulen und Tagungshäuser<br />
sowie schließlich alternative Träger.<br />
Die Volkshochschulen machen ein gutes Viertel<br />
ihrer Befragungsstichprobe aus, ebenso<br />
wie die alternativen Träger. Die „anderen“ Träger<br />
sind mit knapp 40 % am stärksten vertreten,<br />
während Träger der politischen Bildung<br />
nur ca. 10 % ausmachen. Gefragt wurde detailliert<br />
nach der Situation und Qualifikation des<br />
Personals sowie nach Maßnahmen zur Herstellung<br />
von Gleichberechtigung. Neben Fragen<br />
nach der Dauer der Existenz der Weiterbildungseinrichtung<br />
gehören dazu auch Fragen<br />
nach der Zahl der Beschäftigten in verschiedenen<br />
Bereichen von pädagogischer Arbeit bis<br />
zu Hauswirtschaft, nach der Lohnstruktur, den<br />
Abschlüssen, nach Förderplänen und Bildungs(urlaubs)maßnahmen.<br />
Die Ergebnisse werden detailliert <strong>für</strong> die verschiedenen<br />
Träger wie <strong>für</strong> jede einzelne Frage<br />
des Fragebogens präsentiert, so daß das Buch<br />
auch als Materialsammlung nutzbar ist.<br />
Insgesamt stellt Birgit Meyer-Ehlert fest, daß in<br />
der Weiterbildung weitgehend männlich bestimmte<br />
geschlechtshierarchische Strukturen<br />
und geschlechtsstereotype Verteilungen vorzufinden<br />
sind, d.h., die <strong>Erwachsenenbildung</strong><br />
widerspiegelt die allgemeine geschlechtsspezifische<br />
Arbeitsteilung in dieser Gesellschaft.<br />
Dies betrifft auch den Zusammenhang<br />
von familiärer Situation und beruflicher Stellung.<br />
An der Universität Dortmund wurde das weiterbildende<br />
Studium „Frauenstudien“ zunächst<br />
als Modellversuch konzipiert und erprobt und<br />
schließlich 1992 fest etabliert. Der von Irmhild<br />
Kettschau u.a. herausgegebene Band beinhaltet<br />
den Abschlußbericht des Modellversuchs<br />
sowie einige Erfahrungsberichte von beteiligten<br />
Dozentinnen, Politikerinnen und Teilnehmerinnen.<br />
Das weiterbildende Studium zielt auf „emanzipatorische<br />
Frauenarbeit“ als berufliches Aufgabenfeld.<br />
Ausgangspunkt seiner Konzipierung<br />
war der Versuch, „informelle Qualifikationen<br />
aus Familienarbeit und Ehrenamt“ sowohl<br />
beim Zugang zu den Studien wie bei der<br />
inhaltlichen Gestaltung zu berücksichtigen (S.<br />
15). 153 Frauen nahmen während der Modellversuchszeit<br />
in drei Studiengruppen am weiterbildenden<br />
Studium teil. Als curriculare Zielsetzungen<br />
des Modellversuchs formulierten<br />
die Initiatorinnen folgende:<br />
„Tätigkeitsbereiche der emanzipatorischen<br />
Frauenarbeit sind – mit zunehmender Tendenz<br />
– vertreten in <strong>Institut</strong>ionen und Organisationen<br />
der <strong>Erwachsenenbildung</strong>, der Wohlfahrtspflege<br />
und -beratung, in Kirchen, Verbänden,<br />
Gewerkschaften und Unternehmen,<br />
Verwaltungen und Medien wie im politischen<br />
Bereich auf kommunaler, regionaler, Landesund<br />
Bundesebene.<br />
Leitendes Ziel der emanzipatorischen Frauenarbeit<br />
ist es, über Frauen benachteiligende<br />
Strukturen aufzuklären und Bedingungen <strong>für</strong><br />
eine gleichberechtigte und gleichwertige Partizipation<br />
beider Geschlechter in allen gesellschaftlichen<br />
Bereichen – insbesondere in Familie,<br />
Beruf und Öffentlichkeit – zu schaffen“<br />
(S. 41).<br />
Das Curriculum umfaßt sieben Studienschwerpunkte,<br />
von denen zwei ausgewählt werden<br />
müssen. Diese Schwerpunkte sind Familie und<br />
Haushalt, Arbeit und Beruf, Bildung und Qualifikation,<br />
Öffentlichkeit und Politik, Umwelt und<br />
Gesundheit, Kunst und Kultur, Didaktik und<br />
Methodik. Weiteres Gliederungsprinzip sind<br />
drei unterschiedliche Studienbereiche, nämlich<br />
– spezielle Veranstaltungen <strong>für</strong> das weiterbildende<br />
Studium Frauenstudien,<br />
– Veranstaltungen zur Frauenforschung,<br />
– Veranstaltungen von Fachwissenschaften<br />
(S. 43).<br />
159