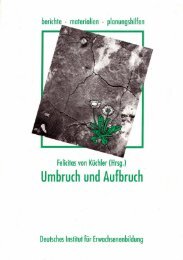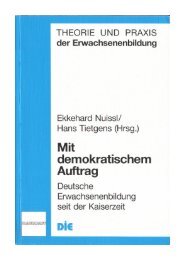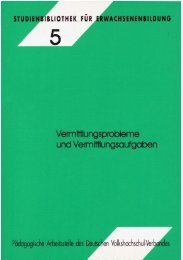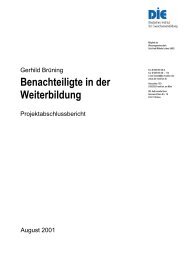Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
end sich das Dritte-Welt-Gesamtangebot seit 1976 mehr als verdoppelt hat, sind<br />
die Angebote zu reinen Entwicklungsthemen in dieser Zeit im Anteil auf ein Drittel<br />
geschrumpft. Die Ausfallquote von ca. 30% in dieser Sparte liegt deutlich über der<br />
Durchschnittsquote aller Dritte-Welt-Angebote von 18%. D.h., die Bereitschaft, sich<br />
mit rein entwicklungspolitischen Fragen in institutionalisierten Angeboten zu beschäftigen,<br />
ist gering und hat abgenommen. Die Abbildung 1 gibt die Verteilung der<br />
Themenbereiche an deutschen Volkshochschulen 1990 wieder, wobei die Dominanz<br />
von kulturell und länderkundlich ausgerichteten Angeboten deutlich wird. Lehrplananalysen<br />
anderer Einrichtungen zu diesem Thema sind uns nicht bekannt. Wir vermuten<br />
ein in der Tendenz ähnliches Ergebnis. Die Begründung da<strong>für</strong> ist eigentlich<br />
trivial: Die Gruppe derjenigen, die beruflich eine entwicklungspolitische Weiterbildung<br />
benötigen, ist klein. „Reine“ entwicklungspolitische Themen haben einen nur<br />
entfernten Alltagsbezug.<br />
Die Konsequenz aus dieser Lage hat das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Internationale Zusammenarbeit<br />
(IIZ) in seinen <strong>Erwachsenenbildung</strong>skonzepten zu Problemen von Drittweltländern<br />
gezogen, indem es entwicklungspolitische Inhalte auf Konkretes, Alltagsbezogenes<br />
„herunterbrach“ (IIZ Jahresbericht 1994). In Angeboten vom Typ „Wie<br />
töpfern, weben und kochen andere Kulturen?“ kann unter sachverständiger Anleitung<br />
etwas hergestellt bzw. nachgemacht werden, mit dessen Hilfe ein Verständnis<br />
<strong>für</strong> das Andere der Kultur, aus der die Techniken stammen, entstehen kann und das<br />
als Ausgangspunkt <strong>für</strong> weitere Fragestellungen zur Kultur, Geschichte und schließlich<br />
zur Entwicklung der Ursprungsländer dient. Der Nachteil dieses Ansatzes im<br />
Kontext entwicklungspolitischer Fragestellungen besteht u.E. darin, daß das bindende<br />
Interesse sich mehr auf das bezieht, was einen Zustand repräsentiert, sei es der<br />
Stand der Alltagstechniken oder der verschiedenen Kulturformen. Überlegungen zu<br />
Veränderungen, d.h. Fragen nach Art und Richtung von Entwicklungen, geraten<br />
unter allein kulturorientierter Perspektive leicht aus dem Blickfeld. Aufgrund einer<br />
negativen Bewertung des Verlustes alter Handwerkstechniken werden moderne<br />
Veränderungen mit Mißtrauen betrachtet. Aus westeuropäischer Sicht ist der Tonkrug<br />
edel und der Plastikeimer abscheulich – aus afrikanischer Sicht kann das allerdings<br />
anders gesehen werden. Einen Plastikeimer als sinnvoll anzusehen, nachdem<br />
man sich einfühlsam um das Tontöpfern bemüht hat, ist ein schwieriges Problem,<br />
das KursleiterInnen in der Regel wohl dadurch umgehen, daß sie Fragen der<br />
Weiterentwicklung nicht zum Gegenstand ihrer Kursarbeit machen.<br />
Entwicklungsdebatte in Deutschland<br />
Die Gegenposition besteht darin, die Entwicklung in Richtung des Standards der<br />
westlichen Welt als unhinterfragt positiv und gewissermaßen selbstverständlich anzusehen.<br />
Diese zumindest früher weit verbreitete Auffassung wurde schon im Begriff<br />
„Entwicklungsländer“ oder noch krasser im Bilde von den „unterentwickelten“<br />
Ländern festgeschrieben. In Volkshochschul- und anderen Bildungsangeboten zum<br />
98