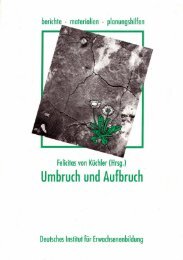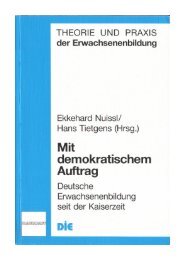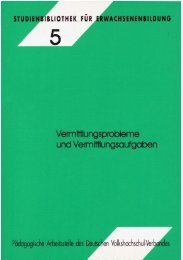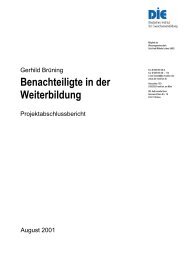Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Volltext - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Thema Dritte Welt dürfte aber eine solche Position kaum vertreten gewesen sein,<br />
weil in aller Regel unter den Teilnehmenden Mitglieder von Dritte-Welt-Gruppen sind,<br />
die sich gegen solche Begriffsverwendungen verwahren, wenn sie von einem Kursleitenden<br />
gebraucht werden sollten. Naiv westzentrierte Positionen haben schon<br />
eher Chancen in Bildungsangeboten, die nicht im direkten Kontext entwicklungspolitischer<br />
Angebote entstehen.<br />
Aber auch diejenigen, die ganz bewußt einem kultur- und technologiepolitischen<br />
Imperialismus entgegentreten wollen, und das sind ganz wesentlich die basisorientierten<br />
Dritte-Welt-Gruppen, haben Schwierigkeiten, ihr Weltbild ohne Bevormundung<br />
durchzuhalten. Das Buch „Small is beautiful“ (Schumacher 1975), das lange<br />
Zeit die “Bibel” <strong>für</strong> entwicklungspolitische Technologievorstellungen war, ist bei<br />
den Intellektuellen in den Dritte-Welt-Ländern in der Regel nur sehr wenig geschätzt<br />
worden. Die rational sehr einleuchtende Empfehlung, die eigene Entwicklung mit<br />
angepaßten Technologien durchzuführen, kann nämlich auch als imperialer Gestus<br />
interpretiert werden. Der deutsche Bauer darf auf einem klimatisierten High-Tech-<br />
Traktor pflügen, und der vietnamesische Bauer soll im Schweiße seiner Muskelanstrengung<br />
den Pflug vom Ochsen ziehen lassen.<br />
Wir sind heute in der glücklichen oder auch unglücklichen Lage, daß wir bereits auf<br />
eine längere Tradition von „Entwicklungsdebatten“ und auf entsprechend zu interpretierende<br />
Erfahrungen von „Entwicklungsarbeit“ zurückblicken können. Wir finden<br />
auf der einen Seite Positionen, die die gesamte „Entwicklungshilfe“ bzw. alle Versuche,<br />
in Entwicklungsprozessen der Dritten Welt zu intervenieren, in Frage stellen (vgl.<br />
Erler 1985). Auf der anderen Seite wird der Bundeskanzler von vielen Gruppen stark<br />
bedrängt, sein 1992 in Rio gegebenes Versprechen einer Verdoppelung der finanziellen<br />
Mittel <strong>für</strong> Entwicklungsprojekte in der Dritten Welt endlich einzulösen. Unabhängig<br />
von solchen Polarisierungen dürfte bei vielen Ernüchterung eingekehrt sein.<br />
Es herrscht ein relativ breiter Konsens, daß man nicht von der Dritten Welt sprechen<br />
solle, daß in den nicht-westlichen Ländern äußerst unterschiedliche kulturelle, geographische,<br />
politische, soziale etc. Bedingungen herrschen können und daß es als<br />
Konsequenz daraus keine Patentlösungen <strong>für</strong> Entwicklungs- oder Hilfskonzepte<br />
gebe. Jedes Projekt, das vom Westen aus in bester Absicht in Dritte-Welt-Ländern<br />
interveniert, hat Konsequenzen, die nicht alle vorausgesehen werden können und<br />
die je nach Sichtweise auch negativ interpretierbar sind. Das Modell „Entwicklungshilfe“<br />
wird seit einiger Zeit durchaus als problematisch angesehen, ganz gleich, ob<br />
es sich um ein staatlich gelenktes Projekt der Gesellschaft <strong>für</strong> technische Zusammenarbeit<br />
(GTZ) handelt oder ob es ein rühriges Projekt einer Nicht-Regierungs-<br />
Organisation (NRO) betrifft.<br />
Nicht der Süden, sondern der Norden ist „unterentwickelt“<br />
Die Frage, wie der entwicklungspolitische Diskurs aussehen kann, hat in jüngster<br />
Zeit durch die ökologische Debatte eine neue Variante erhalten, die viele Probleme<br />
99