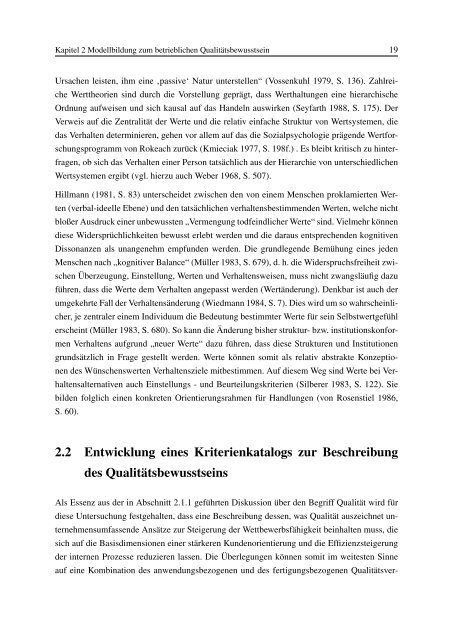Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitel 2 Modellbildung <strong>zum</strong> betrieblichen Qualitätsbewusstsein 19<br />
Ursachen leisten, ihm eine ‚passive‘ Natur unterstellen“ (Vossenkuhl 1979, S. 136). Zahlreiche<br />
Werttheorien sind durch die Vorstellung geprägt, dass Werthaltungen eine hierarchische<br />
Ordnung aufweisen und sich kausal auf das Handeln auswirken (Seyfarth 1988, S. 175). Der<br />
Verweis auf die Zentralität der Werte und die relativ einfache Struktur von Wertsystemen, die<br />
das Verhalten determinieren, gehen vor allem auf das die Sozialpsychologie prägende Wertforschungsprogramm<br />
von Rokeach zurück (Kmieciak 1977, S. 198f.) . Es bleibt kritisch zu hinterfragen,<br />
ob sich das Verhalten einer Person tatsächlich aus der Hierarchie von unterschiedlichen<br />
Wertsystemen ergibt (vgl. hierzu auch Weber 1968, S. 507).<br />
Hillmann (1981, S. 83) unterscheidet zwischen den von einem Menschen proklamierten Werten<br />
(verbal-ideelle Ebene) und den tatsächlichen verhaltensbestimmenden Werten, welche nicht<br />
bloßer Ausdruck einer unbewussten „Vermengung todfeindlicher Werte“ sind. Vielmehr können<br />
diese Widersprüchlichkeiten bewusst erlebt werden und die daraus entsprechenden kognitiven<br />
Dissonanzen als unangenehm empfunden werden. Die grundlegende Bemühung eines jeden<br />
Menschen nach „kognitiver Balance“ (Müller 1983, S. 679), d. h. die Widerspruchsfreiheit zwischen<br />
Überzeugung, Einstellung, Werten und Verhaltensweisen, muss nicht zwangsläufig dazu<br />
führen, dass die Werte dem Verhalten angepasst werden (Wertänderung). Denkbar ist auch der<br />
umgekehrte Fall der Verhaltensänderung (Wiedmann 1984, S. 7). Dies wird um so wahrscheinlicher,<br />
je zentraler einem Individuum die Bedeutung bestimmter Werte für sein Selbstwertgefühl<br />
erscheint (Müller 1983, S. 680). So kann die Änderung bisher struktur- bzw. institutionskonformen<br />
Verhaltens aufgrund „neuer Werte“ dazu führen, dass diese Strukturen und Institutionen<br />
grundsätzlich in Frage gestellt werden. Werte können somit als relativ abstrakte Konzeptionen<br />
<strong>des</strong> Wünschenswerten Verhaltensziele mitbestimmen. Auf diesem Weg sind Werte bei Verhaltensalternativen<br />
auch Einstellungs - und Beurteilungskriterien (Silberer 1983, S. 122). Sie<br />
bilden folglich einen konkreten Orientierungsrahmen für Handlungen (von Rosenstiel 1986,<br />
S. 60).<br />
2.2 Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur Beschreibung<br />
<strong>des</strong> Qualitätsbewusstseins<br />
Als Essenz aus der in Abschnitt 2.1.1 geführten Diskussion über den Begriff Qualität wird für<br />
diese <strong>Untersuchung</strong> festgehalten, dass eine Beschreibung <strong>des</strong>sen, was Qualität auszeichnet unternehmensumfassende<br />
Ansätze zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beinhalten muss, die<br />
sich auf die Basisdimensionen einer stärkeren Kundenorientierung und die Effizienzsteigerung<br />
der internen Prozesse reduzieren lassen. Die Überlegungen können somit im weitesten Sinne<br />
auf eine Kombination <strong>des</strong> anwendungsbezogenen und <strong>des</strong> fertigungsbezogenen Qualitätsver-