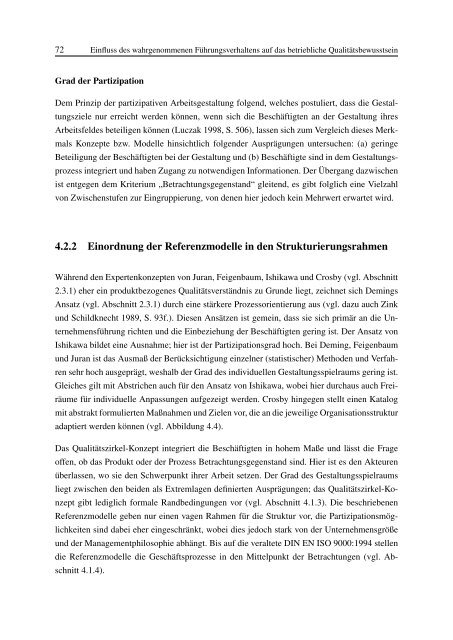Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
72 <strong>Einfluss</strong> <strong>des</strong> <strong>wahrgenommenen</strong> Führungsverhaltens auf das betriebliche Qualitätsbewusstsein<br />
Grad der Partizipation<br />
Dem Prinzip der partizipativen Arbeitsgestaltung folgend, welches postuliert, dass die Gestaltungsziele<br />
nur erreicht werden können, wenn sich die Beschäftigten an der Gestaltung ihres<br />
Arbeitsfel<strong>des</strong> beteiligen können (Luczak 1998, S. 506), lassen sich <strong>zum</strong> Vergleich dieses Merkmals<br />
Konzepte bzw. Modelle hinsichtlich folgender Ausprägungen untersuchen: (a) geringe<br />
Beteiligung der Beschäftigten bei der Gestaltung und (b) Beschäftigte sind in dem Gestaltungsprozess<br />
integriert und haben Zugang zu notwendigen Informationen. Der Übergang dazwischen<br />
ist entgegen dem Kriterium „Betrachtungsgegenstand“ gleitend, es gibt folglich eine Vielzahl<br />
von Zwischenstufen zur Eingruppierung, von denen hier jedoch kein Mehrwert erwartet wird.<br />
4.2.2 Einordnung der Referenzmodelle in den Strukturierungsrahmen<br />
Während den Expertenkonzepten von Juran, Feigenbaum, Ishikawa und Crosby (vgl. Abschnitt<br />
2.3.1) eher ein produktbezogenes Qualitätsverständnis zu Grunde liegt, zeichnet sich Demings<br />
Ansatz (vgl. Abschnitt 2.3.1) durch eine stärkere Prozessorientierung aus (vgl. dazu auch Zink<br />
und Schildknecht 1989, S. 93f.). Diesen Ansätzen ist gemein, dass sie sich primär an die Unternehmensführung<br />
richten und die Einbeziehung der Beschäftigten gering ist. Der Ansatz von<br />
Ishikawa bildet eine Ausnahme; hier ist der Partizipationsgrad hoch. Bei Deming, Feigenbaum<br />
und Juran ist das Ausmaß der Berücksichtigung einzelner (statistischer) Methoden und Verfahren<br />
sehr hoch ausgeprägt, weshalb der Grad <strong>des</strong> individuellen Gestaltungsspielraums gering ist.<br />
Gleiches gilt mit Abstrichen auch für den Ansatz von Ishikawa, wobei hier durchaus auch Freiräume<br />
für individuelle Anpassungen aufgezeigt werden. Crosby hingegen stellt einen Katalog<br />
mit abstrakt formulierten Maßnahmen und Zielen vor, die an die jeweilige Organisationsstruktur<br />
adaptiert werden können (vgl. Abbildung 4.4).<br />
Das Qualitätszirkel-Konzept integriert die Beschäftigten in hohem Maße und lässt die Frage<br />
offen, ob das Produkt oder der Prozess Betrachtungsgegenstand sind. Hier ist es den Akteuren<br />
überlassen, wo sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit setzen. Der Grad <strong>des</strong> Gestaltungsspielraums<br />
liegt zwischen den beiden als Extremlagen definierten Ausprägungen; das Qualitätszirkel-Konzept<br />
gibt lediglich formale Randbedingungen vor (vgl. Abschnitt 4.1.3). Die beschriebenen<br />
Referenzmodelle geben nur einen vagen Rahmen für die Struktur vor, die Partizipationsmöglichkeiten<br />
sind dabei eher eingeschränkt, wobei dies jedoch stark von der Unternehmensgröße<br />
und der Managementphilosophie abhängt. Bis auf die veraltete DIN EN ISO 9000:1994 stellen<br />
die Referenzmodelle die Geschäftsprozesse in den Mittelpunkt der Betrachtungen (vgl. Abschnitt<br />
4.1.4).