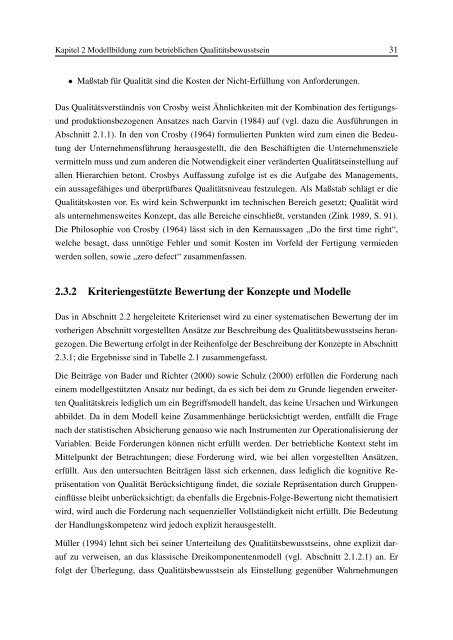Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Empirische Untersuchung zum Einfluss des wahrgenommenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitel 2 Modellbildung <strong>zum</strong> betrieblichen Qualitätsbewusstsein 31<br />
• Maßstab für Qualität sind die Kosten der Nicht-Erfüllung von Anforderungen.<br />
Das Qualitätsverständnis von Crosby weist Ähnlichkeiten mit der Kombination <strong>des</strong> fertigungsund<br />
produktionsbezogenen Ansatzes nach Garvin (1984) auf (vgl. dazu die Ausführungen in<br />
Abschnitt 2.1.1). In den von Crosby (1964) formulierten Punkten wird <strong>zum</strong> einen die Bedeutung<br />
der Unternehmensführung herausgestellt, die den Beschäftigten die Unternehmensziele<br />
vermitteln muss und <strong>zum</strong> anderen die Notwendigkeit einer veränderten Qualitätseinstellung auf<br />
allen Hierarchien betont. Crosbys Auffassung zufolge ist es die Aufgabe <strong>des</strong> Managements,<br />
ein aussagefähiges und überprüfbares Qualitätsniveau festzulegen. Als Maßstab schlägt er die<br />
Qualitätskosten vor. Es wird kein Schwerpunkt im technischen Bereich gesetzt; Qualität wird<br />
als unternehmensweites Konzept, das alle Bereiche einschließt, verstanden (Zink 1989, S. 91).<br />
Die Philosophie von Crosby (1964) lässt sich in den Kernaussagen „Do the first time right“,<br />
welche besagt, dass unnötige Fehler und somit Kosten im Vorfeld der Fertigung vermieden<br />
werden sollen, sowie „zero defect“ zusammenfassen.<br />
2.3.2 Kriteriengestützte Bewertung der Konzepte und Modelle<br />
Das in Abschnitt 2.2 hergeleitete Kriterienset wird zu einer systematischen Bewertung der im<br />
vorherigen Abschnitt vorgestellten Ansätze zur Beschreibung <strong>des</strong> Qualitätsbewusstseins herangezogen.<br />
Die Bewertung erfolgt in der Reihenfolge der Beschreibung der Konzepte in Abschnitt<br />
2.3.1; die Ergebnisse sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.<br />
Die Beiträge von Bader und Richter (2000) sowie Schulz (2000) erfüllen die Forderung nach<br />
einem modellgestützten Ansatz nur bedingt, da es sich bei dem zu Grunde liegenden erweiterten<br />
Qualitätskreis lediglich um ein Begriffsmodell handelt, das keine Ursachen und Wirkungen<br />
abbildet. Da in dem Modell keine Zusammenhänge berücksichtigt werden, entfällt die Frage<br />
nach der statistischen Absicherung genauso wie nach Instrumenten zur Operationalisierung der<br />
Variablen. Beide Forderungen können nicht erfüllt werden. Der betriebliche Kontext steht im<br />
Mittelpunkt der Betrachtungen; diese Forderung wird, wie bei allen vorgestellten Ansätzen,<br />
erfüllt. Aus den untersuchten Beiträgen lässt sich erkennen, dass lediglich die kognitive Repräsentation<br />
von Qualität Berücksichtigung findet, die soziale Repräsentation durch Gruppeneinflüsse<br />
bleibt unberücksichtigt; da ebenfalls die Ergebnis-Folge-Bewertung nicht thematisiert<br />
wird, wird auch die Forderung nach sequenzieller Vollständigkeit nicht erfüllt. Die Bedeutung<br />
der Handlungskompetenz wird jedoch explizit herausgestellt.<br />
Müller (1994) lehnt sich bei seiner Unterteilung <strong>des</strong> Qualitätsbewusstseins, ohne explizit darauf<br />
zu verweisen, an das klassische Dreikomponentenmodell (vgl. Abschnitt 2.1.2.1) an. Er<br />
folgt der Überlegung, dass Qualitätsbewusstsein als Einstellung gegenüber Wahrnehmungen