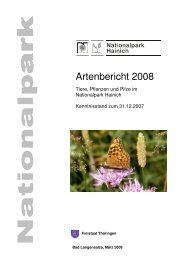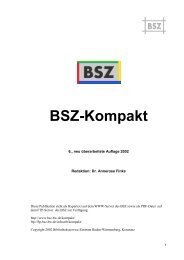Das Forschungszentrum Jülich - d-nb, Archivserver DEPOSIT.D-NB ...
Das Forschungszentrum Jülich - d-nb, Archivserver DEPOSIT.D-NB ...
Das Forschungszentrum Jülich - d-nb, Archivserver DEPOSIT.D-NB ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
überwiegend kleinskalige Phänomene, z.B. konvektive Prozesse oder Anhebung der Luft durch<br />
Wellenaktivität hinweist. Über dem tropischen Atlantik findet sich typischerweise eine bimodale<br />
Feuchteverteilung mit einem trockenen und einem gesättigten Mode. Dagegen liegt in den Extratropen<br />
eine relativ feuchte, aber monomodale Verteilung vor. Die Bimodalität in der Tropen deutet auf starke<br />
Gradienten zwischen trockenen und feuchten Regionen hin, wobei die Abnahme der relativen Feuchte<br />
beim Absinken der Luft relativ schnell sein muss gegenüber den relevanten Zeitkonstanten der<br />
Mischungsprozesse.<br />
Sehr dünne Zirruswolken, die nahe der tropischen Tropopause in Messungen mit dem<br />
Höhenforschungsflugzeug Geophysica 1999 über dem Indischen Ozean beobachtet wurden, besitzen<br />
ein sehr hohes Potential, Luftmassen vor ihrem Eintrag in die Stratosphäre sehr effektiv zu trocknen.<br />
In einer Analyse der Eisübersättigung in solchen Zirren und ihrer Umgebung wurden zwei Klassen von<br />
solchen Wolken unterschieden: Zirren, die sich im Ausfluss von hochreichender Konvektion bilden,<br />
bewirken einen zusätzlichen Wassereintrag in die bereits sehr trockene, aber häufig nicht gesättigte<br />
Luft unterhalb der tropischen Tropopause. Dagegen bewirken Zirren, wie sie sich z.B. durch<br />
Wellenaktivitität in Luftmassen nahe oder oberhalb der Sättigung bilden können, tatsächlich die<br />
Trocknung der Luftmassen auf sehr geringe Wassermischungsverhältnisse.<br />
Diese und andere Feldmessungen von Wasserdampf innerhalb von Zirruswolken zeigen, dass die<br />
relative Feuchte bzgl. Eis deutlich oberhalb der Sättigung liegen kann, vor allem bei tiefen<br />
Temperaturen. Dies wirkt sich auch auf die Größe der Eiskristalle und damit auf die<br />
mikrophysikalischen und Strahlungseigenschaften der Eiswolken aus. Simulationen mit einem neu<br />
entwickelten Modell zeigen, dass die Eisübersättigungen in Zirren mit abnehmender Temperatur,<br />
zunehmender Vertikalgeschwindigkeit, zunehmender Eiskristallgröße und abnehmender Eiskristallzahl<br />
anwächst. Die Relaxationszeit zum thermodynamischen Gleichgewichtszustand verlängert sich von<br />
Sekunden bei Temperaturen von 230K zu Stunden für Temperaturen unterhalb von 200K. <strong>Das</strong> Modell<br />
liefert eine gute Reproduktion der in verschiedenen Feldexperimenten beobachteten Eisübersättigung.<br />
4) <strong>Das</strong> stratosphärische Ozo<strong>nb</strong>udget und dessen Beeinflussung durch den Klimawandel<br />
Schnelle Photochemie und Ozonverlust:<br />
Ein Schwerpunkt der Arbeiten war die Auswertung der Daten der europäischen Euplex Kampagne, die<br />
im Winter 2002/2003 vom ICG-I koordiniert wurde. Während der Euplex Kampagne wurden mit dem<br />
weiterentwickelten HALOX Gerät erstmals ClONO2 und Cl2O2 gemessen. Mittels der<br />
Cl2O2Messungen konnte gezeigt werden, dass die bislang in der Literatur empfohlene<br />
Ratenkonstante für das ClO/Cl2O2 Gleichgewicht zu einer deutlichen Unterschätzung der ClO<br />
Konzentrationen in der polaren Stratosphäre bei Dunkelheit führt. Modellstudien, in die durch eine<br />
Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg auch neue Labor-Messergebnisse zur Cl2O2<br />
Photochemie ei<strong>nb</strong>ezogen werden konnten, zeigen jedoch, dass simulierte Ozonabbauraten relativ<br />
wenig durch die neuen Erkenntnisse über die Cl2O2 Chemie beeinflusst werden.<br />
<strong>Das</strong> CLaMS Modell wurde im Jahr 2004 entscheidend weiterentwickelt; mit der nun operationellen<br />
dreidimensionalen Version wurde der Ozonverlust im Winter 1999/2000 quantifiziert und gezeigt, dass<br />
Mischung durch den Wirbelrand nur zu relativ geringen Änderungen von Ozon-Tracer Korrelationen<br />
führt. Mit dieser Modellversion wurde Transport und Chemie im Arktischen Winter 2002/2003 simuliert<br />
und mit den Messergebnissen der Euplex Kampagne verglichen. Es zeigt sich dass der simulierte<br />
Ozonverlust über den Winter im Bereich der Streuung der verschieden experimentellen Methoden<br />
liegt. Weiterhin beschreibt das Modell erfolgreich die beobachtete Umverteilung von HNO3 durch<br />
sedimentierende stratosphärische Wolkenteilchen; auch das hierfür verwendete Modellmodul ist eine<br />
Neuentwicklung.<br />
Ein wichtiger Schritt war weiterhin eine konsistente Analyse des chemischen Ozonverlustes im<br />
Arktischen Polarwirbel seit 1991/1992 basierend auf Satellitenmessungen. Der chemische<br />
Ozonverlust hängt wie zu erwarten von den Temperaturen in der Polarregion ab; darüber hinaus<br />
konnte aber auch ein Zusammenhang zwischen Ozonverlust und Sonne<strong>nb</strong>estrahlung der kalten<br />
Wirbelregionen sowie zwischen Ozonverlust und Vulkanaktivitäten etabliert werden.<br />
Weiterhin wurde das Zusammenspiel von Dynamik, Mischung und Chemie bei der ersten<br />
beobachteten großen Stratosphärenerwärmung in der Antarktis im Jahr 2002 mittels<br />
Modellrechnungen analysiert. Darüber hinaus wurde aus Satellitenmessungen eine Klimatologie der<br />
124