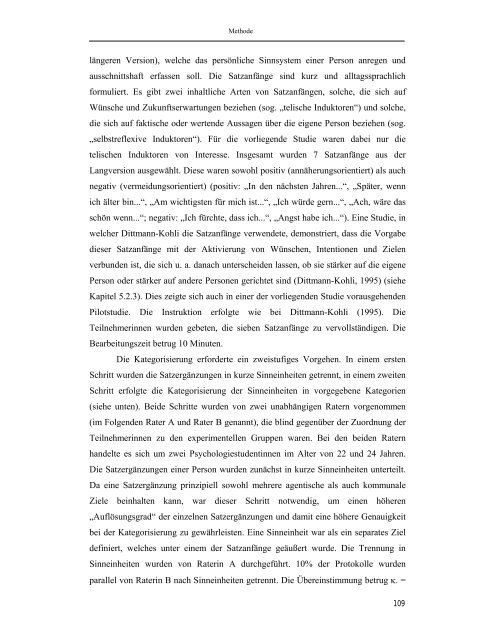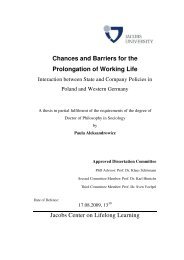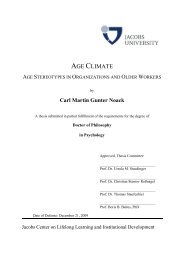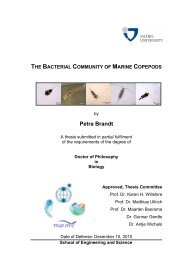Dissertation - Jacobs University
Dissertation - Jacobs University
Dissertation - Jacobs University
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Methode<br />
längeren Version), welche das persönliche Sinnsystem einer Person anregen und<br />
ausschnittshaft erfassen soll. Die Satzanfänge sind kurz und alltagssprachlich<br />
formuliert. Es gibt zwei inhaltliche Arten von Satzanfängen, solche, die sich auf<br />
Wünsche und Zukunftserwartungen beziehen (sog. „telische Induktoren“) und solche,<br />
die sich auf faktische oder wertende Aussagen über die eigene Person beziehen (sog.<br />
„selbstreflexive Induktoren“). Für die vorliegende Studie waren dabei nur die<br />
telischen Induktoren von Interesse. Insgesamt wurden 7 Satzanfänge aus der<br />
Langversion ausgewählt. Diese waren sowohl positiv (annäherungsorientiert) als auch<br />
negativ (vermeidungsorientiert) (positiv: „In den nächsten Jahren...“, „Später, wenn<br />
ich älter bin...“, „Am wichtigsten für mich ist...“, „Ich würde gern...“, „Ach, wäre das<br />
schön wenn...“; negativ: „Ich fürchte, dass ich...“, „Angst habe ich...“). Eine Studie, in<br />
welcher Dittmann-Kohli die Satzanfänge verwendete, demonstriert, dass die Vorgabe<br />
dieser Satzanfänge mit der Aktivierung von Wünschen, Intentionen und Zielen<br />
verbunden ist, die sich u. a. danach unterscheiden lassen, ob sie stärker auf die eigene<br />
Person oder stärker auf andere Personen gerichtet sind (Dittmann-Kohli, 1995) (siehe<br />
Kapitel 5.2.3). Dies zeigte sich auch in einer der vorliegenden Studie vorausgehenden<br />
Pilotstudie. Die Instruktion erfolgte wie bei Dittmann-Kohli (1995). Die<br />
Teilnehmerinnen wurden gebeten, die sieben Satzanfänge zu vervollständigen. Die<br />
Bearbeitungszeit betrug 10 Minuten.<br />
Die Kategorisierung erforderte ein zweistufiges Vorgehen. In einem ersten<br />
Schritt wurden die Satzergänzungen in kurze Sinneinheiten getrennt, in einem zweiten<br />
Schritt erfolgte die Kategorisierung der Sinneinheiten in vorgegebene Kategorien<br />
(siehe unten). Beide Schritte wurden von zwei unabhängigen Ratern vorgenommen<br />
(im Folgenden Rater A und Rater B genannt), die blind gegenüber der Zuordnung der<br />
Teilnehmerinnen zu den experimentellen Gruppen waren. Bei den beiden Ratern<br />
handelte es sich um zwei Psychologiestudentinnen im Alter von 22 und 24 Jahren.<br />
Die Satzergänzungen einer Person wurden zunächst in kurze Sinneinheiten unterteilt.<br />
Da eine Satzergänzung prinzipiell sowohl mehrere agentische als auch kommunale<br />
Ziele beinhalten kann, war dieser Schritt notwendig, um einen höheren<br />
„Auflösungsgrad“ der einzelnen Satzergänzungen und damit eine höhere Genauigkeit<br />
bei der Kategorisierung zu gewährleisten. Eine Sinneinheit war als ein separates Ziel<br />
definiert, welches unter einem der Satzanfänge geäußert wurde. Die Trennung in<br />
Sinneinheiten wurden von Raterin A durchgeführt. 10% der Protokolle wurden<br />
parallel von Raterin B nach Sinneinheiten getrennt. Die Übereinstimmung betrug κ. =<br />
109