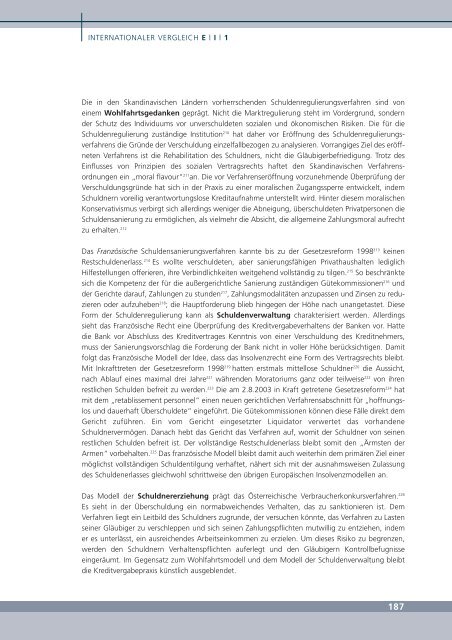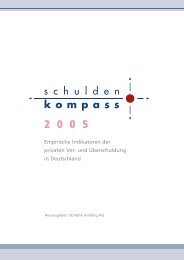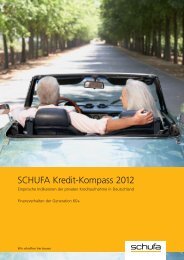Die private Überschuldung im internationalen Vergleich
Die private Überschuldung im internationalen Vergleich
Die private Überschuldung im internationalen Vergleich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
INTERNATIONALER VERGLEICH E | I | 1<br />
<strong>Die</strong> in den Skandinavischen Ländern vorherrschenden Schuldenregulierungsverfahren sind von<br />
einem Wohlfahrtsgedanken geprägt. Nicht die Marktregulierung steht <strong>im</strong> Vordergrund, sondern<br />
der Schutz des Individuums vor unverschuldeten sozialen und ökonomischen Risiken. <strong>Die</strong> für die<br />
Schuldenregulierung zuständige Institution 210 hat daher vor Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens<br />
die Gründe der Verschuldung einzelfallbezogen zu analysieren. Vorrangiges Ziel des eröffneten<br />
Verfahrens ist die Rehabilitation des Schuldners, nicht die Gläubigerbefriedigung. Trotz des<br />
Einflusses von Prinzipien des sozialen Vertragsrechts haftet den Skandinavischen Verfahrensordnungen<br />
ein „moral flavour“ 211 an. <strong>Die</strong> vor Verfahrenseröffnung vorzunehmende Überprüfung der<br />
Verschuldungsgründe hat sich in der Praxis zu einer moralischen Zugangssperre entwickelt, indem<br />
Schuldnern voreilig verantwortungslose Kreditaufnahme unterstellt wird. Hinter diesem moralischen<br />
Konservativismus verbirgt sich allerdings weniger die Abneigung, überschuldeten Privatpersonen die<br />
Schuldensanierung zu ermöglichen, als vielmehr die Absicht, die allgemeine Zahlungsmoral aufrecht<br />
zu erhalten. 212<br />
Das Französische Schuldensanierungsverfahren kannte bis zu der Gesetzesreform 1998 213 keinen<br />
Restschuldenerlass. 214 Es wollte verschuldeten, aber sanierungsfähigen Privathaushalten lediglich<br />
Hilfestellungen offerieren, ihre Verbindlichkeiten weitgehend vollständig zu tilgen. 215 So beschränkte<br />
sich die Kompetenz der für die außergerichtliche Sanierung zuständigen Gütekommissionen 216 und<br />
der Gerichte darauf, Zahlungen zu stunden 217 , Zahlungsmodalitäten anzupassen und Zinsen zu reduzieren<br />
oder aufzuheben 218 ; die Hauptforderung blieb hingegen der Höhe nach unangetastet. <strong>Die</strong>se<br />
Form der Schuldenregulierung kann als Schuldenverwaltung charakterisiert werden. Allerdings<br />
sieht das Französische Recht eine Überprüfung des Kreditvergabeverhaltens der Banken vor. Hatte<br />
die Bank vor Abschluss des Kreditvertrages Kenntnis von einer Verschuldung des Kreditnehmers,<br />
muss der Sanierungsvorschlag die Forderung der Bank nicht in voller Höhe berücksichtigen. Damit<br />
folgt das Französische Modell der Idee, dass das Insolvenzrecht eine Form des Vertragsrechts bleibt.<br />
Mit Inkrafttreten der Gesetzesreform 1998 219 hatten erstmals mittellose Schuldner 220 die Aussicht,<br />
nach Ablauf eines max<strong>im</strong>al drei Jahre 221 währenden Moratoriums ganz oder teilweise 222 von ihren<br />
restlichen Schulden befreit zu werden. 223 <strong>Die</strong> am 2.8.2003 in Kraft getretene Gesetzesreform 224 hat<br />
mit dem „retablissement personnel“ einen neuen gerichtlichen Verfahrensabschnitt für „hoffnungslos<br />
und dauerhaft Überschuldete“ eingeführt. <strong>Die</strong> Gütekommissionen können diese Fälle direkt dem<br />
Gericht zuführen. Ein vom Gericht eingesetzter Liquidator verwertet das vorhandene<br />
Schuldnervermögen. Danach hebt das Gericht das Verfahren auf, womit der Schuldner von seinen<br />
restlichen Schulden befreit ist. Der vollständige Restschuldenerlass bleibt somit den „Ärmsten der<br />
Armen“ vorbehalten. 225 Das französische Modell bleibt damit auch weiterhin dem pr<strong>im</strong>ären Ziel einer<br />
möglichst vollständigen Schuldentilgung verhaftet, nähert sich mit der ausnahmsweisen Zulassung<br />
des Schuldenerlasses gleichwohl schrittweise den übrigen Europäischen Insolvenzmodellen an.<br />
Das Modell der Schuldnererziehung prägt das Österreichische Verbraucherkonkursverfahren. 226<br />
Es sieht in der <strong>Überschuldung</strong> ein normabweichendes Verhalten, das zu sanktionieren ist. Dem<br />
Verfahren liegt ein Leitbild des Schuldners zugrunde, der versuchen könnte, das Verfahren zu Lasten<br />
seiner Gläubiger zu verschleppen und sich seinen Zahlungspflichten mutwillig zu entziehen, indem<br />
er es unterlässt, ein ausreichendes Arbeitseinkommen zu erzielen. Um dieses Risiko zu begrenzen,<br />
werden den Schuldnern Verhaltenspflichten auferlegt und den Gläubigern Kontrollbefugnisse<br />
eingeräumt. Im Gegensatz zum Wohlfahrtsmodell und dem Modell der Schuldenverwaltung bleibt<br />
die Kreditvergabepraxis künstlich ausgeblendet.<br />
187