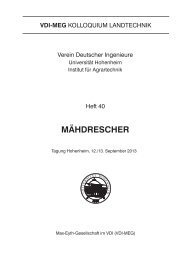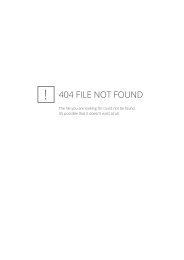Dokument 2.pdf - OPUS-Datenbank - Universität Hohenheim
Dokument 2.pdf - OPUS-Datenbank - Universität Hohenheim
Dokument 2.pdf - OPUS-Datenbank - Universität Hohenheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6.4 Vergleich der eingesetzten Methoden<br />
konnten lediglich 23 regulierte Proteine mit allen eingesetzten Methoden erfasst werden.<br />
Die Unterschiede zwischen den Methoden lassen sich vor allem durch die Komplexität<br />
der analysierten Proben erklären. Da nur eine gewisse Anzahl von Peptiden pro Zeiteinheit<br />
massenspektrometrisch identifiziert bzw. quantifiziert werden kann, wurde in<br />
allen Experimenten die Komplexität der Probe vor der LC-ESI-MS/MS-Analyse deutlich<br />
reduziert. Dies wurde zum einen über gelbasierte Fraktionierung auf Proteinebene<br />
(2D-DIGE, 1D-Fraktionierung) zum anderen durch chromatographische Trennung<br />
der Peptide über lange RP-HPLC-Gradienten (Membranfraktion) erreicht. Von jedem<br />
Trennverfahren werden identische Proteine bzw. Peptide unterschiedlich gut erfasst,<br />
was sich auf die Wahrscheinlichkeit einer Identifizierung in der nachfolgenden massenspektrometrischen<br />
Analyse auswirkt. Zudem gelangen trotz reduzierter Komplexität<br />
pro Zeiteinheit mehr Peptide in das Massenspektrometer als analysiert werden können.<br />
Besonders Peptide, welche nur in geringer Zahl vorliegen und somit eine geringe<br />
Signal-Intensität aufweisen, werden häufig nicht reproduzierbar für eine Fragmentierung<br />
ausgewählt und somit seltener identifiziert. Um einen möglichst großen Teil der<br />
regulierten Proteine zu erfassen, erscheint es daher sinnvoll, mehrere Analysemethoden<br />
zu kombinieren. Den besten Überblick über das Gesamtproteom liefert sicherlich<br />
die GeLCMSMS-Analyse, welche allerdings auch die längste Analysezeit in Anspruch<br />
nimmt.<br />
Auffällig sind die teilweise deutlichen Unterschiede in den Regulationsfaktoren zwischen<br />
2D-DIGE- und GeLCMSMS-Experimenten. Da es sich um unabhängige Methoden handelt,<br />
sind deren Regulationsfaktoren nicht vergleichbar. Zudem geben die Werte in allen<br />
eigesetzten Methoden nur ein relatives Verhältnis zwischen den untersuchten Zuständen<br />
wieder.<br />
Während die Quantifizierung in 2D-DIGE-Experimenten auf der Fluoreszenz der markierten<br />
Proteine beruht, erfolgt die Quantifizierung in GeLCMSMS-Experimenten auf<br />
Basis der beim Verdau erzeugter Peptide (mindesten zwei je Protein). In 2D-DIGE-<br />
Experimenten haben alle Proteine eines Spots einen Einfluss auf den Regulationsfaktor,<br />
da diese alle zur Fluoreszenz des Spots beitragen. Da sich bei der labelfreien Quantifizierung<br />
der Regulationsfaktor eines Proteins aus den Regulationsfaktoren der detektierten<br />
Peptide berechnet, nimmt mit der Zahl der identifizierten Peptide eines Proteins auch<br />
die Präzision des Regulationsfaktors zu. Auch die Signalintensitäten der zur Quantifizierung<br />
verwendeten „Features“ sowie deren reproduzierbare Detektion in den unterschiedlichen<br />
biologischen Replikaten haben einen entscheidenden Einfluss auf den Regulationsfaktor<br />
eines Proteins. Da sich neben diesen experimentellen Parametern auch die<br />
Berechnung der Regulationsfaktoren zwischen den unterschiedlichen Methoden unterscheidet,<br />
sollte die Größe der ermittelten Faktoren nicht als absolut angesehen werden.<br />
Für eine präzisere Bestimmung der Regulationsfaktoren sei auf Methoden, welche die<br />
231