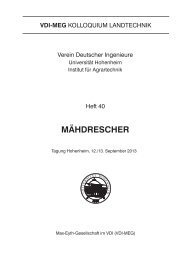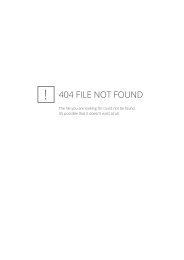Dokument 2.pdf - OPUS-Datenbank - Universität Hohenheim
Dokument 2.pdf - OPUS-Datenbank - Universität Hohenheim
Dokument 2.pdf - OPUS-Datenbank - Universität Hohenheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3 Einleitung<br />
schwierig. Substanzen, welche die Solubilisierung von Proteinen verbessern (Detergenzien,<br />
Salze) sind wiederum nicht mit massenspektrometrischen Analysen kompatibel<br />
oder würden deren Sensitivität stark reduzieren. Daher werden in Ansätzen, welche die<br />
Identifizierung von Proteinen in komplexen Proben zum Ziel haben, durch eine spezifische<br />
Protease erzeugte Peptide anstelle ganzer Proteine analysiert (sog. „bottom-up“<br />
Ansatz).<br />
Als Protease wird aufgrund seiner Spezifität, Stabilität und Aktivität (geringe Anzahl<br />
an Fehlschnitten) häufig Trypsin verwendet. Trypsin, welches C-terminal von Lysin und<br />
Arginin schneidet, erzeugt in der Regel Peptide in einer für die Massenspektrometrie<br />
geeigneten Größe, welche neben der N-terminalen Aminogruppe an den Seitenketten<br />
von Lysin und Arginin noch eine zweite Aminogruppe tragen. Dies ist im Hinblick auf<br />
Ionisation und Fragmentierung der Peptide ideal (Lottspeich, 2012). Neben der Bestimmung<br />
des m/z-Verhältnisses eines Peptides sind für eine präzise Identifizierung auch<br />
Informationen über die Aminosäuresequenz des Peptides von großem Vorteil. Diese<br />
Information kann im Rahmen einer massenspektrometrischen Analyse durch eine Fragmentierung<br />
von Peptiden mittels verschiedener Verfahren (CID, ETD, HCD) erhalten<br />
werden und wird als MS/MS oder MS 2 -Analyse bezeichnet.<br />
Die Analyse von Peptiden anstelle ganzer Proteine bringt jedoch auch eine weitere<br />
Steigerung der Komplexität der Probe mit sich. Besonders bei im Vorfeld nicht fraktionierten<br />
Proben, können auch moderne Massenspektrometer nicht alle in einer Probe<br />
vorhandenen Peptide erfassen. Um die Komplexität der Probe zu reduzieren, wird der<br />
eigentlichen massenspektrometrischen Analyse ein chromatographisches Trennverfahren<br />
vorangestellt. Da sich die Anforderungen im Hinblick auf die Trennung je nach<br />
Fragestellung unterscheiden, wurden auch in diesem Bereich eine Vielzahl von Methoden<br />
und Geräten entwickelt. Einen Überblick gibt der Review von Sandra et al. (2008).<br />
Die gängigste Methode zur Trennung von Peptiden ist die RP-HPLC (Reversed-Phase<br />
High Performance Liquid Chromatography) bei der die einzelnen Peptide aufgrund<br />
ihrer Hydrophobizität voneinander getrennt werden. Nach der initialen Bindung der<br />
Peptide an ein hydrophobes Säulenmaterial erfolgt deren sukzessive Elution. Durch<br />
die Erhöhung des Anteils an organischem Lösungsmittel in der mobilen Phase werden<br />
die Peptide, nach steigender Hydrophobizität geordnet, von der Säule gelöst. Da für<br />
die Elution flüchtige Lösungsmittel verwendet werden, die keine für das MS störenden<br />
Substanzen wie z.B. Salze enthalten, kann die Reversed-Phase Chromatographie<br />
direkt („online“) an ein mit einer entsprechenden Ionen-Quelle ausgestattetes Massenspektrometer<br />
gekoppelt werden. Wie Abbildung 3.7 zeigt, erhält die Analyse durch die<br />
Online-Kopplung zusätzlich zum ermittelten m/z-Verhältnis eine zeitliche Dimension<br />
(Contour-Plot, X-Achse). Der Contour-Plot ist eine Darstellung, welche alle Informationen<br />
eines LC-MS-Experiments (nicht MS/MS) in einer Grafik zusammenfasst. Dabei<br />
22