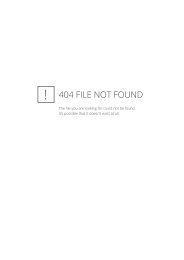3022248 SPD Antragsbuch Inhalt.indd
3022248 SPD Antragsbuch Inhalt.indd
3022248 SPD Antragsbuch Inhalt.indd
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anträge<br />
Empfehlungen<br />
der Antragskommission<br />
ßerlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Ihre Organisation wird<br />
von Körperschaften öffentlichen Rechts (Krankenkassen, Kassenärztlichen<br />
Vereinigungen und Heilberufekammern) als mittelbare<br />
staatliche Aufgabenwahrnehmung oder in der Krankenhausplanung<br />
und –Versorgung öffentlich gewährleistet. Neue Steuerungen haben<br />
diesen öffentlichen Auftrag weniger erkennbar werden lassen.<br />
Gesundheitspolitik zwischen Versorgung und Effizienz<br />
Gesundheitspolitik befindet sich immer im Spannungsfeld zwischen<br />
Versorgungsoptimierung und Kostenentwicklung. Die Nachfragedefinition<br />
durch die Anbieter führt in einem marktlichen System<br />
notwendig zu Überversorgung und resultierenden hohen Kontroll-<br />
und Regulierungsaufwand. Gleichzeitig entsteht Unter- und<br />
Fehlversorgung, vor allem dort, wo Leistungen sich vordergründig<br />
nicht “rechnen“. Die Kostenfrage dominiert seit den achtziger Jahren<br />
die Gesundheitspolitik, während Versorgungs- und Strukturfragen<br />
lange zurückgetreten sind.<br />
Für uns gilt: der Pflichtbeitrag der Beschäftigten muss sparsam verwendet<br />
werden. Überversorgung, z. B. aus finanziellen Interessen<br />
von Leistungserbringern, bedeutet sowohl Verschwendung als auch<br />
einen Qualitätsmangel und eine unnötige Gefährdung. Die Solidarität<br />
der Beitragszahler kann nur durch rationale Mittelverwendung<br />
gesichert werden.<br />
Die mit dem Kompromiss von Lahnstein begonnene marktorientierte<br />
Wende der Gesundheitspolitik hat auch erhebliche Erfolge<br />
gezeigt: durch die Begrenzung der Honorarsteigerung auf die Lohnentwicklung<br />
konnten die ambulanten Ausgaben gedämpft werden.<br />
Durch den Wettbewerb der Krankenkassen kam es zu einer deutlichen<br />
Effizienzsteigerung und Neuaufstellung. Fallpauschen haben<br />
zu einer deutlichen Verkürzung von Liegezeiten im Krankenhaus<br />
und Stärkung ambulanter Versorgung geführt. Kosten-Nutzen Prüfungen<br />
und Arzneimittelrabattverträge konnten erhebliche Summen<br />
einsparen.<br />
Grenzen der Effizienzverbesserung in vielen Bereichen erreicht<br />
oder überschritten<br />
Inzwischen sind viele dieser Potentiale gehoben und die vorrangig<br />
kostenorientierten, am Produktionssektor orientierten Methoden<br />
stoßen zusehends an Grenzen. Die Stärkung der betriebswirtschaftlichen<br />
Steuerung führte notwendig zu einer Verbreiterung<br />
ökonomischer Kategorien und Denkmuster in der Alltagspraxis<br />
der Akteure. Was im makro-Maßstab wünschenswertes Konzept<br />
ist (Beitragssatzstabilität, sparsamer Ressourcenverbrauch, wettbewerbliche<br />
Allokation wie z. B. beim Arzneimittelhandel), kann<br />
auf der mikro-Ebene der therapeutischen Beziehung zu unerträglichen<br />
Ergebnissen führen: denn hier muss immer die Versorgung<br />
des konkreten Patienten vorgehen.<br />
Im ambulanten Bereich haben Kostensenkungsverfahren zu erheblichen<br />
Ausweichreaktionen bis hin zur regelmäßigen Verletzung<br />
elementarer Regeln der ärztlichen Ethik geführt. Behandlungs- und<br />
Verordnungsverweigerungen trotz Behandlungsbedarf scheinen an<br />
der Tagesordnung. Mit sog. IGeL Leistungen wird regelmäßig ärztliche<br />
Autorität zu gewerblichen Zwecken missbraucht. Die Versorgung<br />
in benachteiligten Regionen und auf dem Land wird zunehmend<br />
schwieriger, während Wohlstandsviertel überversorgt sind.<br />
Die marktmäßige Orientierung und der Versuch, das Handeln der<br />
Heilberufsangehörigen durch externe, monetäre Anreize zu steuern,<br />
verdrängt die unverzichtbare intrinsische Motivation der Heilberufe:<br />
wer ständig auf den eigenen Geldvorteil schauen soll, der<br />
passt sich an und verliert stückweise die Motivation aus dem „Helfersyndrom“<br />
– mit allen beschriebenen schädlichen Folgen von<br />
Qualitätsverlust und Kostensteigerung. Das Ende ökonomisierten<br />
Denkens ist „Missfeldertum“: Versorgung nur für die, bei denen es<br />
sich wirtschaftlich lohnt.<br />
Festbetragsregelungen im Heilmittelbereich führen offenbar zu regelmäßiger<br />
Übervorteilung der Betroffenen. Arzneimittelwechsel<br />
durch Rabattverträge werden teilweise als belasten erlebt und können<br />
zu Complianceproblemen führen. Im Wettbewerb der Kran-<br />
1<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
55<br />
60<br />
65<br />
109




![Gesamter Wortlaut der Rede von Sigmar Gabriel [PDF] - SPD](https://img.yumpu.com/22803291/1/184x260/gesamter-wortlaut-der-rede-von-sigmar-gabriel-pdf-spd.jpg?quality=85)
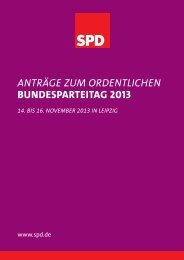

![Beschlussbuch [ PDF , 4,6 MB ] - SPD](https://img.yumpu.com/21925732/1/184x260/beschlussbuch-pdf-46-mb-spd.jpg?quality=85)
![Antragsbuch [ PDF , 161 kB ] - SPD](https://img.yumpu.com/21902361/1/184x260/antragsbuch-pdf-161-kb-spd.jpg?quality=85)

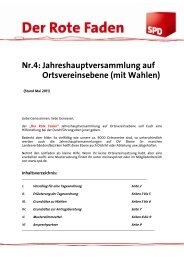

![Protokoll [ PDF , 2 MB] - SPD](https://img.yumpu.com/15086716/1/184x260/protokoll-pdf-2-mb-spd.jpg?quality=85)