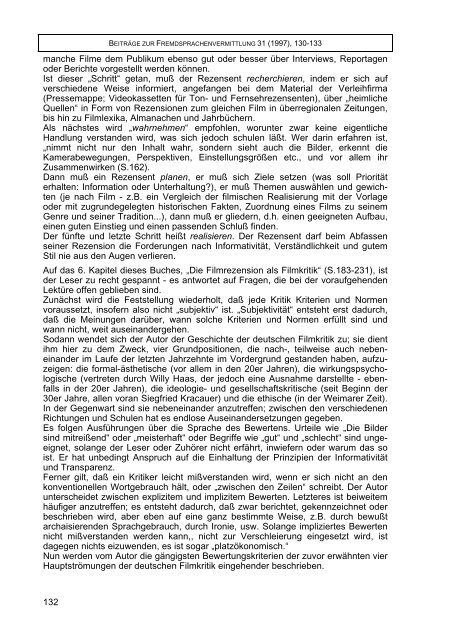impressum - KOPS - Universität Konstanz
impressum - KOPS - Universität Konstanz
impressum - KOPS - Universität Konstanz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
132<br />
BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 31 (1997), 130-133<br />
manche Filme dem Publikum ebenso gut oder besser über Interviews, Reportagen<br />
oder Berichte vorgestellt werden können.<br />
Ist dieser „Schritt“ getan, muß der Rezensent recherchieren, indem er sich auf<br />
verschiedene Weise informiert, angefangen bei dem Material der Verleihfirma<br />
(Pressemappe; Videokassetten für Ton- und Fernsehrezensenten), über „heimliche<br />
Quellen“ in Form von Rezensionen zum gleichen Film in überregionalen Zeitungen,<br />
bis hin zu Filmlexika, Almanachen und Jahrbüchern.<br />
Als nächstes wird „wahrnehmen“ empfohlen, worunter zwar keine eigentliche<br />
Handlung verstanden wird, was sich jedoch schulen läßt. Wer darin erfahren ist,<br />
„nimmt nicht nur den Inhalt wahr, sondern sieht auch die Bilder, erkennt die<br />
Kamerabewegungen, Perspektiven, Einstellungsgrößen etc., und vor allem ihr<br />
Zusammenwirken (S.162).<br />
Dann muß ein Rezensent planen, er muß sich Ziele setzen (was soll Priorität<br />
erhalten: Information oder Unterhaltung?), er muß Themen auswählen und gewichten<br />
(je nach Film - z.B. ein Vergleich der filmischen Realisierung mit der Vorlage<br />
oder mit zugrundegelegten historischen Fakten, Zuordnung eines Films zu seinem<br />
Genre und seiner Tradition...), dann muß er gliedern, d.h. einen geeigneten Aufbau,<br />
einen guten Einstieg und einen passenden Schluß finden.<br />
Der fünfte und letzte Schritt heißt realisieren. Der Rezensent darf beim Abfassen<br />
seiner Rezension die Forderungen nach Informativität, Verständlichkeit und gutem<br />
Stil nie aus den Augen verlieren.<br />
Auf das 6. Kapitel dieses Buches, „Die Filmrezension als Filmkritik“ (S.183-231), ist<br />
der Leser zu recht gespannt - es antwortet auf Fragen, die bei der voraufgehenden<br />
Lektüre offen geblieben sind.<br />
Zunächst wird die Feststellung wiederholt, daß jede Kritik Kriterien und Normen<br />
voraussetzt, insofern also nicht „subjektiv“ ist. „Subjektivität“ entsteht erst dadurch,<br />
daß die Meinungen darüber, wann solche Kriterien und Normen erfüllt sind und<br />
wann nicht, weit auseinandergehen.<br />
Sodann wendet sich der Autor der Geschichte der deutschen Filmkritik zu; sie dient<br />
ihm hier zu dem Zweck, vier Grundpositionen, die nach-, teilweise auch nebeneinander<br />
im Laufe der letzten Jahrzehnte im Vordergrund gestanden haben, aufzuzeigen:<br />
die formal-ästhetische (vor allem in den 20er Jahren), die wirkungspsychologische<br />
(vertreten durch Willy Haas, der jedoch eine Ausnahme darstellte - ebenfalls<br />
in der 20er Jahren), die ideologie- und gesellschaftskritische (seit Beginn der<br />
30er Jahre, allen voran Siegfried Kracauer) und die ethische (in der Weimarer Zeit).<br />
In der Gegenwart sind sie nebeneinander anzutreffen; zwischen den verschiedenen<br />
Richtungen und Schulen hat es endlose Auseinandersetzungen gegeben.<br />
Es folgen Ausführungen über die Sprache des Bewertens. Urteile wie „Die Bilder<br />
sind mitreißend“ oder „meisterhaft“ oder Begriffe wie „gut“ und „schlecht“ sind ungeeignet,<br />
solange der Leser oder Zuhörer nicht erfährt, inwiefern oder warum das so<br />
ist. Er hat unbedingt Anspruch auf die Einhaltung der Prinzipien der Informativität<br />
und Transparenz.<br />
Ferner gilt, daß ein Kritiker leicht mißverstanden wird, wenn er sich nicht an den<br />
konventionellen Wortgebrauch hält, oder „zwischen den Zeilen“ schreibt. Der Autor<br />
unterscheidet zwischen explizitem und implizitem Bewerten. Letzteres ist beiweitem<br />
häufiger anzutreffen; es entsteht dadurch, daß zwar berichtet, gekennzeichnet oder<br />
beschrieben wird, aber eben auf eine ganz bestimmte Weise, z.B. durch bewußt<br />
archaisierenden Sprachgebrauch, durch Ironie, usw. Solange impliziertes Bewerten<br />
nicht mißverstanden werden kann,, nicht zur Verschleierung eingesetzt wird, ist<br />
dagegen nichts eizuwenden, es ist sogar „platzökonomisch.“<br />
Nun werden vom Autor die gängigsten Bewertungskriterien der zuvor erwähnten vier<br />
Hauptströmungen der deutschen Filmkritik eingehender beschrieben.