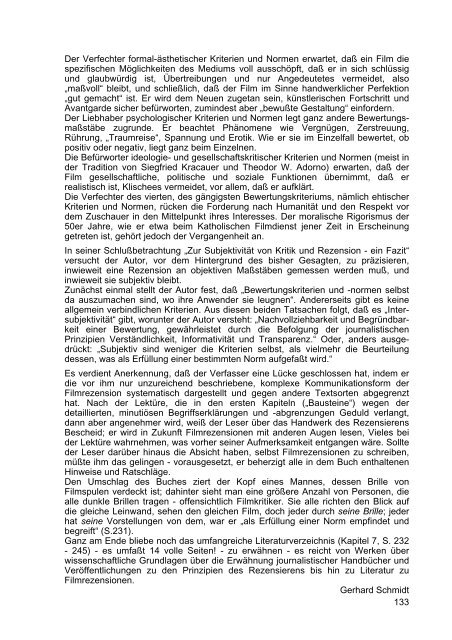impressum - KOPS - Universität Konstanz
impressum - KOPS - Universität Konstanz
impressum - KOPS - Universität Konstanz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Verfechter formal-ästhetischer Kriterien und Normen erwartet, daß ein Film die<br />
spezifischen Möglichkeiten des Mediums voll ausschöpft, daß er in sich schlüssig<br />
und glaubwürdig ist, Übertreibungen und nur Angedeutetes vermeidet, also<br />
„maßvoll“ bleibt, und schließlich, daß der Film im Sinne handwerklicher Perfektion<br />
„gut gemacht“ ist. Er wird dem Neuen zugetan sein, künstlerischen Fortschritt und<br />
Avantgarde sicher befürworten, zumindest aber „bewußte Gestaltung“ einfordern.<br />
Der Liebhaber psychologischer Kriterien und Normen legt ganz andere Bewertungsmaßstäbe<br />
zugrunde. Er beachtet Phänomene wie Vergnügen, Zerstreuung,<br />
Rührung, „Traumreise“, Spannung und Erotik. Wie er sie im Einzelfall bewertet, ob<br />
positiv oder negativ, liegt ganz beim Einzelnen.<br />
Die Befürworter ideologie- und gesellschaftskritischer Kriterien und Normen (meist in<br />
der Tradition von Siegfried Kracauer und Theodor W. Adorno) erwarten, daß der<br />
Film gesellschaftliche, politische und soziale Funktionen übernimmt, daß er<br />
realistisch ist, Klischees vermeidet, vor allem, daß er aufklärt.<br />
Die Verfechter des vierten, des gängigsten Bewertungskriteriums, nämlich ehtischer<br />
Kriterien und Normen, rücken die Forderung nach Humanität und den Respekt vor<br />
dem Zuschauer in den Mittelpunkt ihres Interesses. Der moralische Rigorismus der<br />
50er Jahre, wie er etwa beim Katholischen Filmdienst jener Zeit in Erscheinung<br />
getreten ist, gehört jedoch der Vergangenheit an.<br />
In seiner Schlußbetrachtung „Zur Subjektivität von Kritik und Rezension - ein Fazit“<br />
versucht der Autor, vor dem Hintergrund des bisher Gesagten, zu präzisieren,<br />
inwieweit eine Rezension an objektiven Maßstäben gemessen werden muß, und<br />
inwieweit sie subjektiv bleibt.<br />
Zunächst einmal stellt der Autor fest, daß „Bewertungskriterien und -normen selbst<br />
da auszumachen sind, wo ihre Anwender sie leugnen“. Andererseits gibt es keine<br />
allgemein verbindlichen Kriterien. Aus diesen beiden Tatsachen folgt, daß es „Intersubjektivität“<br />
gibt, worunter der Autor versteht: „Nachvollziehbarkeit und Begründbarkeit<br />
einer Bewertung, gewährleistet durch die Befolgung der journalistischen<br />
Prinzipien Verständlichkeit, Informativität und Transparenz.“ Oder, anders ausgedrückt:<br />
„Subjektiv sind weniger die Kriterien selbst, als vielmehr die Beurteilung<br />
dessen, was als Erfüllung einer bestimmten Norm aufgefaßt wird.“<br />
Es verdient Anerkennung, daß der Verfasser eine Lücke geschlossen hat, indem er<br />
die vor ihm nur unzureichend beschriebene, komplexe Kommunikationsform der<br />
Filmrezension systematisch dargestellt und gegen andere Textsorten abgegrenzt<br />
hat. Nach der Lektüre, die in den ersten Kapiteln („Bausteine“) wegen der<br />
detaillierten, minutiösen Begriffserklärungen und -abgrenzungen Geduld verlangt,<br />
dann aber angenehmer wird, weiß der Leser über das Handwerk des Rezensierens<br />
Bescheid; er wird in Zukunft Filmrezensionen mit anderen Augen lesen, Vieles bei<br />
der Lektüre wahrnehmen, was vorher seiner Aufmerksamkeit entgangen wäre. Sollte<br />
der Leser darüber hinaus die Absicht haben, selbst Filmrezensionen zu schreiben,<br />
müßte ihm das gelingen - vorausgesetzt, er beherzigt alle in dem Buch enthaltenen<br />
Hinweise und Ratschläge.<br />
Den Umschlag des Buches ziert der Kopf eines Mannes, dessen Brille von<br />
Filmspulen verdeckt ist; dahinter sieht man eine größere Anzahl von Personen, die<br />
alle dunkle Brillen tragen - offensichtlich Filmkritiker. Sie alle richten den Blick auf<br />
die gleiche Leinwand, sehen den gleichen Film, doch jeder durch seine Brille; jeder<br />
hat seine Vorstellungen von dem, war er „als Erfüllung einer Norm empfindet und<br />
begreift“ (S.231).<br />
Ganz am Ende bliebe noch das umfangreiche Literaturverzeichnis (Kapitel 7, S. 232<br />
- 245) - es umfaßt 14 volle Seiten! - zu erwähnen - es reicht von Werken über<br />
wissenschaftliche Grundlagen über die Erwähnung journalistischer Handbücher und<br />
Veröffentlichungen zu den Prinzipien des Rezensierens bis hin zu Literatur zu<br />
Filmrezensionen.<br />
Gerhard Schmidt<br />
133