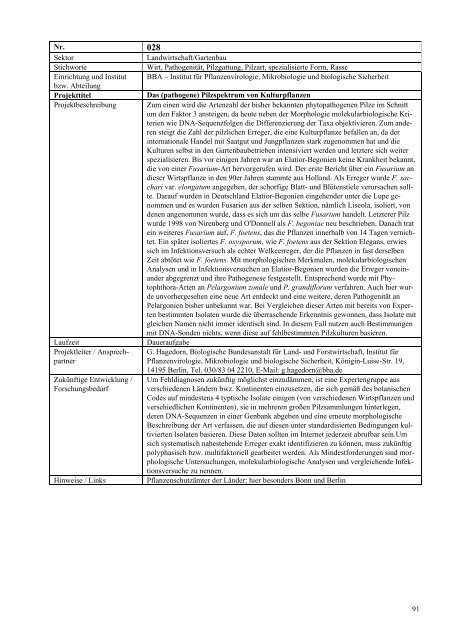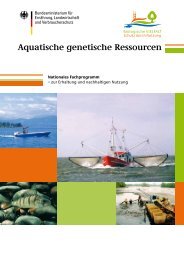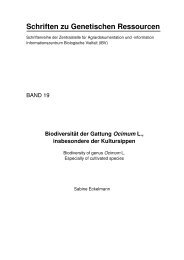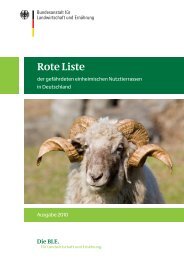Forschungsarbeiten zum Thema Biodiversität aus den ... - Genres
Forschungsarbeiten zum Thema Biodiversität aus den ... - Genres
Forschungsarbeiten zum Thema Biodiversität aus den ... - Genres
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 028<br />
Sektor Landwirtschaft/Gartenbau<br />
Stichworte Wirt, Pathogenität, Pilzgattung, Pilzart, spezialisierte Form, Rasse<br />
Einrichtung und Institut BBA – Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit<br />
bzw. Abteilung<br />
Projekttitel Das (pathogene) Pilzspektrum von Kulturpflanzen<br />
Projektbeschreibung Zum einen wird die Artenzahl der bisher bekannten phytopathogenen Pilze im Schnitt<br />
um <strong>den</strong> Faktor 3 ansteigen, da heute neben der Morphologie molekularbiologische Kriterien<br />
wie DNA-Sequenzfolgen die Differenzierung der Taxa objektivieren. Zum anderen<br />
steigt die Zahl der pilzlichen Erreger, die eine Kulturpflanze befallen an, da der<br />
internationale Handel mit Saatgut und Jungpflanzen stark zugenommen hat und die<br />
Kulturen selbst in <strong>den</strong> Gartenbaubetrieben intensiviert wer<strong>den</strong> und letztere sich weiter<br />
spezialisieren. Bis vor einigen Jahren war an Elatior-Begonien keine Krankheit bekannt,<br />
die von einer Fusarium-Art hervorgerufen wird. Der erste Bericht über ein Fusarium an<br />
dieser Wirtspflanze in <strong>den</strong> 90er Jahren stammte <strong>aus</strong> Holland. Als Erreger wurde F. sacchari<br />
var. elongatum angegeben, der schorfige Blatt- und Blütenstiele verursachen sollte.<br />
Darauf wur<strong>den</strong> in Deutschland Elatior-Begonien eingehender unter die Lupe genommen<br />
und es wur<strong>den</strong> Fusarien <strong>aus</strong> der selben Sektion, nämlich Liseola, isoliert, von<br />
<strong>den</strong>en angenommen wurde, dass es sich um das selbe Fusarium handelt. Letzterer Pilz<br />
wurde 1998 von Nirenberg und O'Donnell als F. begoniae neu beschrieben. Danach trat<br />
ein weiteres Fusarium auf, F. foetens, das die Pflanzen innerhalb von 14 Tagen vernichtet.<br />
Ein später isoliertes F. oxysporum, wie F. foetens <strong>aus</strong> der Sektion Elegans, erwies<br />
sich im Infektionsversuch als echter Welkeerreger, der die Pflanzen in fast derselben<br />
Zeit abtötet wie F. foetens. Mit morphologischen Merkmalen, molekularbiologischen<br />
Analysen und in Infektionsversuchen an Elatior-Begonien wur<strong>den</strong> die Erreger voneinander<br />
abgegrenzt und ihre Pathogenese festgestellt. Entsprechend wurde mit Phytophthora-Arten<br />
an Pelargonium zonale und P. grandiflorum verfahren. Auch hier wurde<br />
unvorhergesehen eine neue Art entdeckt und eine weitere, deren Pathogenität an<br />
Pelargonien bisher unbekannt war. Bei Vergleichen dieser Arten mit bereits von Experten<br />
bestimmten Isolaten wurde die überraschende Erkenntnis gewonnen, dass Isolate mit<br />
gleichen Namen nicht immer i<strong>den</strong>tisch sind. In diesem Fall nutzen auch Bestimmungen<br />
mit DNA-Son<strong>den</strong> nichts, wenn diese auf fehlbestimmten Pilzkulturen basieren.<br />
Laufzeit Daueraufgabe<br />
Projektleiter / Ansprechpartner<br />
Zukünftige Entwicklung /<br />
Forschungsbedarf<br />
G. Hagedorn, Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für<br />
Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Königin-Luise-Str. 19,<br />
14195 Berlin, Tel. 030/83 04 2210, E-Mail: g.hagedorn@bba.de<br />
Um Fehldiagnosen zukünftig möglichst einzudämmen, ist eine Expertengruppe <strong>aus</strong><br />
verschie<strong>den</strong>en Ländern bwz. Kontinenten einzusetzen, die sich gemäß des botanischen<br />
Codes auf mindestens 4 typtische Isolate einigen (von verschie<strong>den</strong>en Wirtspflanzen und<br />
verschiedlichen Kontinenten), sie in mehreren großen Pilzsammlungen hinterlegen,<br />
deren DNA-Sequenzen in einer Genbank abgeben und eine erneute morphologische<br />
Beschreibung der Art verfassen, die auf diesen unter standardisierten Bedingungen kultivierten<br />
Isolaten basieren. Diese Daten sollten im Internet jederzeit abrufbar sein.Um<br />
sich systematisch nahestehende Erreger exakt i<strong>den</strong>tifizieren zu können, muss zukünftig<br />
polyphasisch bzw. multifaktoriell gearbeitet wer<strong>den</strong>. Als Mindestforderungen sind morphologische<br />
Untersuchungen, molekularbiologische Analysen und vergleichende Infektionsversuche<br />
zu nennen.<br />
Hinweise / Links Pflanzenschutzämter der Länder; hier besonders Bonn und Berlin<br />
91