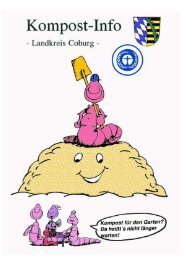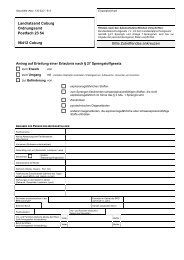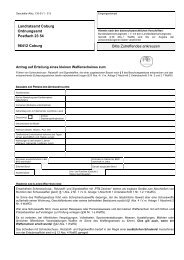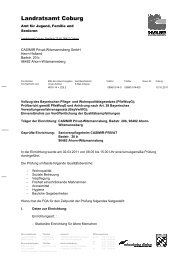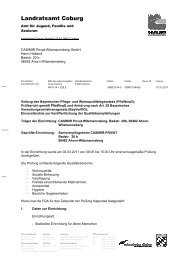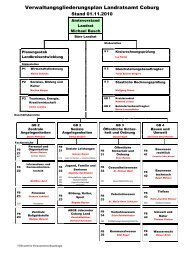- Seite 1: Integriertes Klimaschutzkonzept des
- Seite 4 und 5: Diese Studie wurde beauftragt von:
- Seite 6 und 7: Seite 4 von 166
- Seite 8 und 9: 5 KWK-Analyse .....................
- Seite 10 und 11: 1 Zusammenfassung Der Landkreis Cob
- Seite 12 und 13: CO 2-Emissionen in t CO 2 950.000 7
- Seite 14 und 15: Auf Grundlage dieser Zahlen ergeben
- Seite 16 und 17: Der Anteil an den gesamten CO2-Emis
- Seite 18 und 19: MWh 900.000 800.000 700.000 600.000
- Seite 20 und 21: � Verkehr Der Energieverbrauch de
- Seite 22 und 23: � Effizienzpotenziale kommunaler
- Seite 24 und 25: Beleuchtung (59 %) verwirklicht. Ma
- Seite 26 und 27: deutschlandweiten Durchschnitt lieg
- Seite 28 und 29: Maßnahmenkatalog Im Maßnahmenkata
- Seite 30 und 31: 2 Einleitung 2.1 Zielsetzung und In
- Seite 32 und 33: 2.3 Energiewende im Jahr 2011 Am 11
- Seite 34 und 35: 2.4.2 Bevölkerungsentwicklung bis
- Seite 36 und 37: Wohnfläche in 1.000 m 2 Abbildung
- Seite 38 und 39: angemeldeten Kfz pro 1000 EW um kna
- Seite 40 und 41: Abbildung 24: Prozentuale Änderung
- Seite 42 und 43: 3.1 Leitungsgebundene Energieträge
- Seite 44 und 45: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20
- Seite 46 und 47: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20
- Seite 48 und 49: und Erlangen eine hohe Anzahl von F
- Seite 50 und 51: Fernwärmenetz verfügen. Somit ble
- Seite 54 und 55: verwendeten Energieträger sind unt
- Seite 56 und 57: 4.1.2 Wohnungsbaugesellschaft und W
- Seite 58 und 59: 4.1.4 Basisszenario, Best-Practice-
- Seite 60 und 61: eine Reduktion des Heizwärmebedarf
- Seite 62 und 63: Folgende Grafik zeigt die Entwicklu
- Seite 64 und 65: 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Abbil
- Seite 66 und 67: Folgende Abbildung zeigt den spezif
- Seite 68 und 69: kWh/qm Abbildung 49: Benchmark Wär
- Seite 70 und 71: zw. sehr guten energetischen Zustan
- Seite 72 und 73: Rödental aber auch Liegenschaften
- Seite 74 und 75: Im Rahmen der Programme KfW-Kredit
- Seite 76 und 77: Ein Großteil der eingesetzten Ener
- Seite 78 und 79: Für die Heizwärmebereitstellung w
- Seite 80 und 81: Abbildung 63: Stellenwert Energieef
- Seite 82 und 83: Abbildung 65: Effizienzpotenziale B
- Seite 84 und 85: Auf Grundlage der ökonomischen Rah
- Seite 86 und 87: 5.5.1 Fossile KWK-Anlagen (Basissze
- Seite 88 und 89: Höhe von drei Cent je kWhel durch
- Seite 90 und 91: 6 Potenzialberechnungen der Erneuer
- Seite 92 und 93: 6.1.1 Photovoltaik Die Stromerzeugu
- Seite 94 und 95: Stromerzeugung und CO2-Einsparung d
- Seite 96 und 97: sonstigen Einschränkungen ist nur
- Seite 98 und 99: 6.1.1.3 Best-Practice-Szenario für
- Seite 100 und 101: Bei den Wohngebäuden wurde auf 80
- Seite 102 und 103:
6.2 Windenergie Das im Mai 2011 von
- Seite 104 und 105:
Zubau von 25 Anlagen mit durchschni
- Seite 106 und 107:
6.3 Wasserkraft - derzeitige Strome
- Seite 108 und 109:
sieht auch das Bayerische Energieko
- Seite 110 und 111:
6.4.2 Basis-Szenario für die Strom
- Seite 112 und 113:
6.5 Feste Biomasse (Holz) Bei feste
- Seite 114 und 115:
Die nachfolgende Tabelle zeigt die
- Seite 116 und 117:
6.6 Zusammenfassung Strom- und Wär
- Seite 118 und 119:
6.7 Regionale Wertschöpfung durch
- Seite 120 und 121:
Zusammenfassende Darstellung der We
- Seite 122 und 123:
6.7.2 Mögliche Wertschöpfungseffe
- Seite 124 und 125:
6.7.4 Mögliche Wertschöpfungseffe
- Seite 126 und 127:
6.7.6 Mögliche Wertschöpfungseffe
- Seite 128 und 129:
- Öffentlicher Personennahverkehr:
- Seite 130 und 131:
Abbildung 80:Wegzwecke nach Verkehr
- Seite 132 und 133:
Für die Fortschreibung des Verkehr
- Seite 134 und 135:
Abbildung 83 Steigerung Anzahl Kraf
- Seite 136 und 137:
der voraussichtlich im Dezember 201
- Seite 138 und 139:
Fahrleistung in pkm 40.000.000 35.0
- Seite 140 und 141:
Als positiv zu bewerten ist der Bes
- Seite 142 und 143:
7.5.1 Ausblick Motorisierter Indivi
- Seite 144 und 145:
eingesetzt werden und in nachfrages
- Seite 146 und 147:
indirekte Anreize wie überdachte A
- Seite 148 und 149:
Abbildung 87: Elektromobilität Mar
- Seite 150 und 151:
ANHANG Seite 148 von 166
- Seite 152 und 153:
Abbildung 57: Energieanwendungen im
- Seite 154 und 155:
Abkürzungsverzeichnis Seite 152 vo
- Seite 156 und 157:
Literatur und Datenquellen AELF (20
- Seite 158 und 159:
LfL (2008a): Faustzahlen für die B
- Seite 160 und 161:
www.bafa.de www.biomasseatlas.de ww
- Seite 162 und 163:
ANHANG II Tabellenblätter Wertsch
- Seite 164 und 165:
II.3 Mögliche regionale Wertschöp
- Seite 166 und 167:
II.5 Tabellenblatt: Mögliche regio
- Seite 168 und 169:
Zusammenfassung der Daten Zusammenf
- Seite 170:
Diese Studie wurde beauftragt von:
- Seite 173 und 174:
3.3 Informationskampagne Solarenerg
- Seite 175 und 176:
Einleitung Seite 1 von 57 Maßnahme
- Seite 177 und 178:
1 Maßnahmen im kommunalen Aufgaben
- Seite 179 und 180:
1.2 Formulierung von Klimaschutzzie
- Seite 181 und 182:
1.3.1 Energieeinsparkonzept bei San
- Seite 183 und 184:
1.3.3 Schulung für kommunale Mitar
- Seite 185 und 186:
1.3.5 Energieliefer-Contracting Inh
- Seite 187 und 188:
Seite 13 von 57 Maßnahmenkatalog I
- Seite 189 und 190:
2 Maßnahmen im Bereich Bauen und S
- Seite 191 und 192:
Seite 17 von 57 Maßnahmenkatalog I
- Seite 193 und 194:
2.4 Veröffentlichung von Best-Prac
- Seite 195 und 196:
Seite 21 von 57 Maßnahmenkatalog I
- Seite 197 und 198:
3 Maßnahmen im Bereich Erneuerbare
- Seite 199 und 200:
3.2 Schaffung von Strukturen zur B
- Seite 201 und 202:
3.4 Solarflächenkataster im Landkr
- Seite 203 und 204:
Seite 29 von 57 Maßnahmenkatalog I
- Seite 205 und 206:
4.2 Informationskampagne Energieeff
- Seite 207 und 208:
Seite 33 von 57 Maßnahmenkatalog I
- Seite 209 und 210:
5.1 Arbeitskreis Nahmobilität Inha
- Seite 211 und 212:
5.3 Förderung des ÖPNV Inhalt und
- Seite 213 und 214:
5.5 Elektromobilität der kommunale
- Seite 215 und 216:
5.7 Jubiläum: 125 Jahre Elektroaut
- Seite 217 und 218:
6 Maßnahmen im Bereich Öffentlich
- Seite 219 und 220:
Seite 45 von 57 Maßnahmenkatalog I
- Seite 221 und 222:
6.4 Regelmäßige Informationsveran
- Seite 223 und 224:
6.6 Umweltbildung: JugendSolarProgr
- Seite 225 und 226:
6.8 Fortführung Initiativkreis und
- Seite 227 und 228:
6.10 Social Media/Blogs Inhalt und
- Seite 229 und 230:
6.12 Veranstaltungsreihe: Film&Talk
- Seite 231 und 232:
Seite 57 von 57 ANHANG Aus den Init
- Seite 233 und 234:
Diese Studie wurde beauftragt von:
- Seite 235 und 236:
Wie versenden? ....................
- Seite 237 und 238:
Einleitung Die Energiewende - jetzt
- Seite 239 und 240:
Zusammenfassung Klimaschutz erforde
- Seite 241 und 242:
privates Kapital zum Bau von Anlage
- Seite 243 und 244:
Klimaschutz: Landkreis Coburg start
- Seite 245 und 246:
Aktiver Arbeitskreis in der Stadt C
- Seite 247 und 248:
Erster Schritt: Optimierung der vor
- Seite 249 und 250:
Seite 18 von 90
- Seite 251 und 252:
Mehr Akzeptanz für Ausbau der Wind
- Seite 253 und 254:
Unterschiedliche Mobilitätsformen
- Seite 255 und 256:
Bund Naturschutz: Aufgeschlossen f
- Seite 257 und 258:
Studiengang „Energieeffizientes G
- Seite 259 und 260:
Ökologie-Pioniere: Die Ökologisch
- Seite 261 und 262:
Flächendeckendes Angebot für Stad
- Seite 263 und 264:
Elektromobilität als Mittel zur Ku
- Seite 265 und 266:
Regionalmanagement: Zentrale Schnit
- Seite 267 und 268:
Regionale Banken und Sparkassen: Wi
- Seite 269 und 270:
Gretchenfrage: Wer macht die Arbeit
- Seite 271 und 272:
Erneuerbare Wärme: 25% bis 2020 si
- Seite 273 und 274:
Auch Politik und Verwaltung wollen
- Seite 275 und 276:
Ständige Herausforderung: Informat
- Seite 277 und 278:
Knappe personelle Ressourcen erford
- Seite 279 und 280:
Zielgruppen definieren und gezielt
- Seite 281 und 282:
Alle Wege nutzen: Ansprache über d
- Seite 283 und 284:
Tageszeitungen überregional Abendz
- Seite 285 und 286:
Antenne Bayern Korrespondentenbüro
- Seite 287 und 288:
Online-Medien - - Freie Journaliste
- Seite 289 und 290:
Pressemitteilung: Beschränkung auf
- Seite 291 und 292:
Gewinnspiele schaffen zusätzliche
- Seite 293 und 294:
Regelmäßiger Email- Newsletter: E
- Seite 295 und 296:
Klimaschutz- oder Energieratgeber:
- Seite 297 und 298:
Schlüsselposition Klimaschutzmanag
- Seite 299 und 300:
Mit der Dachmarke wird Klimaschutz
- Seite 301 und 302:
Mit Bausteinen arbeiten: Eine Kampa
- Seite 303 und 304:
Workshops ermöglichen Vertiefung u
- Seite 305 und 306:
Messen und Ausstellungen:Klimaschut
- Seite 307 und 308:
Aktionen versprechen erhöhte Aufme
- Seite 309 und 310:
klimabelastend erzeugtes Fleisch, m
- Seite 311 und 312:
Vorschlag im Initiativkreis: Umwelt
- Seite 313 und 314:
Kultur und Klimaschutz: Ansprache a
- Seite 315 und 316:
Abbildung 21: Federicos Kirschen Sp
- Seite 317 und 318:
Abbildung 26: Plastic Planet A/D 20
- Seite 319 und 320:
Abbildung 30: Yellow Cake D 2010, 1
- Seite 321:
werden. In der Regel sind bei TV-Do