Aus dem Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit des
Aus dem Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit des
Aus dem Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit des
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
142<br />
Diskussion<br />
Als Lagerungsmedium <strong>für</strong> die mikroverkapselten Stämme L. reuteri (S 24),<br />
L. rhamnosus (S 25), L. paracasei (S 26) <strong>und</strong> L. gasseri (S 28) wurde Speisegelatine<br />
ausgewählt, da diese eine häufige Zutat in Fleischerzeugnissen ist <strong>und</strong> zu<strong>dem</strong> gute<br />
Träger- <strong>und</strong> Bindungseigenschaften aufweist. Speziell wurde die GELITA ®<br />
Speisegelatine, 240 Bloom 20 mesh PS, ausgewählt, <strong>und</strong> in einer üblichen<br />
Verdünnung 100 g pro 900 ml Aqua. <strong>des</strong>t. angesetzt <strong>und</strong> gelöst. In diesem Verhältnis<br />
erwies sich die Gelatine als stabil <strong>und</strong> zeigte gute Geliereigenschaften. Je 10 ml<br />
wurden in die Lagerungsröhrchen abgefüllt <strong>und</strong> bei 121 °C ± 0,5 °C autoklaviert<br />
(Lagerungsmedium Nr. 1). Der Kochverlust durch das Autoklavieren verteilte sich wie<br />
auch bei den Nährmedien <strong>und</strong> Lösungen auf alle Röhrchen in gleichem Maße.<br />
Nach <strong>Aus</strong>wertung der Vorversuche (siehe Kap. 3.2.2) wurden, wie bereits in Kapitel<br />
5.2 diskutiert, <strong>für</strong> den Lagerungsversuch als Zusätze 5 % NaCl (Lagerungsmedium<br />
Nr. 2), 10 % Nelken (Lagerungsmedium Nr. 3) bzw. 10 % Schwarzer Pfeffer<br />
(Lagerungsmedium Nr. 4) ausgewählt, da diese zu einer deutlichen Beeinträchtigung<br />
<strong>des</strong> Wachstums der vier probiotischen Stämme L. reuteri (S 24), L. rhamnosus<br />
(S 25), L. paracasei (S 26) <strong>und</strong> L. gasseri (S 28) führten.<br />
Die Probenröhrchen wurden bei zwei Temperaturen gelagert: gekühlt bei<br />
2 °C ± 0,5 °C, sowie bei einer Raumtemperatur von 20 °C ± 0,5 °C. Die<br />
zugelassenen Temperaturschwankungen während der Lagerung betrafen wiederum<br />
alle Proben in gleichem Maße.<br />
Die 200 verschiedenen Proben wurden zu Beginn der Lagerung (Zeitpunkt Null, U1)<br />
<strong>und</strong> anschließend zu sechs weiteren Untersuchungszeitpunkten (U2, U3, U4, U5, U6<br />
<strong>und</strong> U7) in vierwöchigem Abstand untersucht. Damit ergaben sich <strong>für</strong> jede Probe<br />
sieben Werte (U1 bis U7). Der Probenschlüssel ist in Kapitel 3.2.5.2 (Tab. 18) <strong>und</strong><br />
die Untersuchungszeitpunkte in Kapitel 3.2.6 (Tab. 19) aufgeführt. Die Proben<br />
Nr. 101 bis 200, d. h. die bei 20 °C gelagerten Proben, wurden aus labortechnischen<br />
Gründen jeweils maximal eine Woche später untersucht, was aber alle Proben in<br />
gleichem Maße betraf <strong>und</strong> daher keine <strong>Aus</strong>wirkungen auf die Ergebnisse hatte.






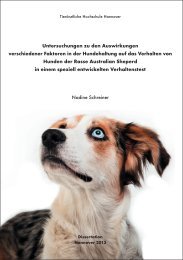



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






