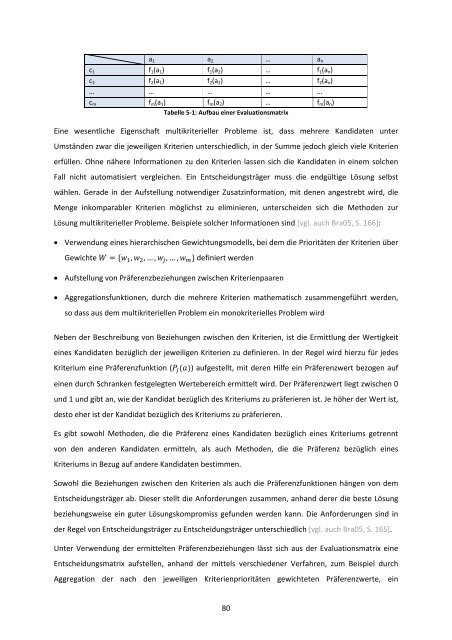Entwicklung eines Kollaborationsnetzwerkes - Bergische Universität ...
Entwicklung eines Kollaborationsnetzwerkes - Bergische Universität ...
Entwicklung eines Kollaborationsnetzwerkes - Bergische Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
a 1 a 2 … a n<br />
c 1 f 1 (a 1 ) f 1 (a 2 ) … f 1 (a n )<br />
c 2 f 2 (a 1 ) f 2 (a 2 ) … f 2 (a n )<br />
… … … … …<br />
c m f m (a 1 ) f m (a 2 ) … f m (a n )<br />
Tabelle 5‐1: Aufbau einer Evaluationsmatrix<br />
Eine wesentliche Eigenschaft multikriterieller Probleme ist, dass mehrere Kandidaten unter<br />
Umständen zwar die jeweiligen Kriterien unterschiedlich, in der Summe jedoch gleich viele Kriterien<br />
erfüllen. Ohne nähere Informationen zu den Kriterien lassen sich die Kandidaten in einem solchen<br />
Fall nicht automatisiert vergleichen. Ein Entscheidungsträger muss die endgültige Lösung selbst<br />
wählen. Gerade in der Aufstellung notwendiger Zusatzinformation, mit denen angestrebt wird, die<br />
Menge inkomparabler Kriterien möglichst zu eliminieren, unterscheiden sich die Methoden zur<br />
Lösung multikriterieller Probleme. Beispiele solcher Informationen sind [vgl. auch Bra05, S. 166]:<br />
Verwendung <strong>eines</strong> hierarchischen Gewichtungsmodells, bei dem die Prioritäten der Kriterien über<br />
Gewichte , ,…, ,…, definiert werden<br />
Aufstellung von Präferenzbeziehungen zwischen Kriterienpaaren<br />
Aggregationsfunktionen, durch die mehrere Kriterien mathematisch zusammengeführt werden,<br />
so dass aus dem multikriteriellen Problem ein monokriterielles Problem wird<br />
Neben der Beschreibung von Beziehungen zwischen den Kriterien, ist die Ermittlung der Wertigkeit<br />
<strong>eines</strong> Kandidaten bezüglich der jeweiligen Kriterien zu definieren. In der Regel wird hierzu für jedes<br />
Kriterium eine Präferenzfunktion ( ) aufgestellt, mit deren Hilfe ein Präferenzwert bezogen auf<br />
einen durch Schranken festgelegten Wertebereich ermittelt wird. Der Präferenzwert liegt zwischen 0<br />
und 1 und gibt an, wie der Kandidat bezüglich des Kriteriums zu präferieren ist. Je höher der Wert ist,<br />
desto eher ist der Kandidat bezüglich des Kriteriums zu präferieren.<br />
Es gibt sowohl Methoden, die die Präferenz <strong>eines</strong> Kandidaten bezüglich <strong>eines</strong> Kriteriums getrennt<br />
von den anderen Kandidaten ermitteln, als auch Methoden, die die Präferenz bezüglich <strong>eines</strong><br />
Kriteriums in Bezug auf andere Kandidaten bestimmen.<br />
Sowohl die Beziehungen zwischen den Kriterien als auch die Präferenzfunktionen hängen von dem<br />
Entscheidungsträger ab. Dieser stellt die Anforderungen zusammen, anhand derer die beste Lösung<br />
beziehungsweise ein guter Lösungskompromiss gefunden werden kann. Die Anforderungen sind in<br />
der Regel von Entscheidungsträger zu Entscheidungsträger unterschiedlich [vgl. auch Bra05, S. 165].<br />
Unter Verwendung der ermittelten Präferenzbeziehungen lässt sich aus der Evaluationsmatrix eine<br />
Entscheidungsmatrix aufstellen, anhand der mittels verschiedener Verfahren, zum Beispiel durch<br />
Aggregation der nach den jeweiligen Kriterienprioritäten gewichteten Präferenzwerte, ein<br />
80