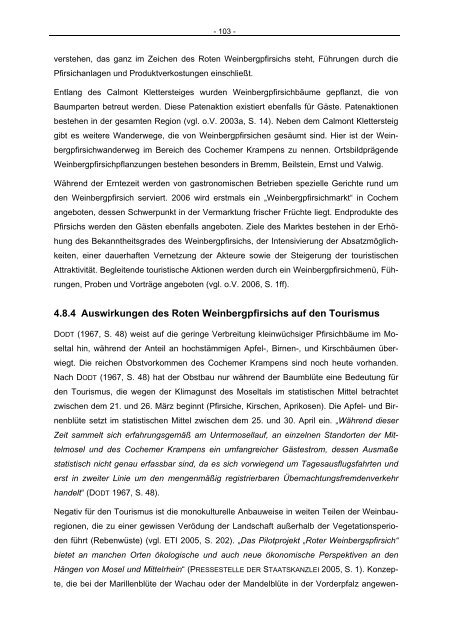Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 103 -<br />
verstehen, das ganz im Zeichen des Roten Weinbergpfirsichs steht, Führungen durch die<br />
Pfirsichanlagen und Produktverkostungen einschließt.<br />
Entlang des Calmont Klettersteiges wurden Weinbergpfirsichbäume gepflanzt, die von<br />
Baumparten betreut werden. Diese Patenaktion existiert ebenfalls <strong>für</strong> Gäste. Patenaktionen<br />
bestehen in der gesamten Region (vgl. o.V. 2003a, S. 14). Neben dem Calmont Klettersteig<br />
gibt es weitere Wanderwege, die von Weinbergpfirsichen gesäumt sind. Hier ist der Weinbergpfirsichwanderweg<br />
im Bereich des Cochemer Krampens zu nennen. Ortsbildprägende<br />
Weinbergpfirsichpflanzungen bestehen besonders in Bremm, Beilstein, Ernst und Valwig.<br />
Während der Erntezeit werden von gastronomischen Betrieben spezielle Gerichte rund um<br />
den Weinbergpfirsich serviert. 2006 wird erstmals ein „Weinbergpfirsichmarkt“ in Cochem<br />
angeboten, dessen Schwerpunkt in der Vermarktung frischer Früchte liegt. Endprodukte des<br />
Pfirsichs werden den Gästen ebenfalls angeboten. Ziele des Marktes bestehen in der Erhöhung<br />
des Bekanntheitsgrades des Weinbergpfirsichs, der Intensivierung der Absatzmöglichkeiten,<br />
einer dauerhaften Vernetzung der Akteure sowie der Steigerung der touristischen<br />
Attraktivität. Begleitende touristische Aktionen werden durch ein Weinbergpfirsichmenü, Führungen,<br />
Proben und Vorträge angeboten (vgl. o.V. 2006, S. 1ff).<br />
4.8.4 Auswirkungen des Roten Weinbergpfirsichs auf den Tourismus<br />
DODT (1967, S. 48) weist auf die geringe Verbreitung kleinwüchsiger Pfirsichbäume im <strong>Mosel</strong>tal<br />
hin, während der Anteil an hochstämmigen Apfel-, Birnen-, und Kirschbäumen überwiegt.<br />
Die reichen Obstvorkommen des Cochemer Krampens sind noch heute vorhanden.<br />
Nach DODT (1967, S. 48) hat der Obstbau nur während der Baumblüte eine Bedeutung <strong>für</strong><br />
den Tourismus, die wegen der Klimagunst des <strong>Mosel</strong>tals im statistischen Mittel betrachtet<br />
zwischen dem 21. und 26. März beginnt (Pfirsiche, Kirschen, Aprikosen). Die Apfel- und Birnenblüte<br />
setzt im statistischen Mittel zwischen dem 25. und 30. April ein. „Während dieser<br />
Zeit sammelt sich erfahrungsgemäß am Untermosellauf, an einzelnen Standorten der Mittelmosel<br />
und des Cochemer Krampens ein umfangreicher Gästestrom, dessen Ausmaße<br />
statistisch nicht genau erfassbar sind, da es sich vorwiegend um Tagesausflugsfahrten und<br />
erst in zweiter Linie um den mengenmäßig registrierbaren Übernachtungsfremdenverkehr<br />
handelt“ (DODT 1967, S. 48).<br />
Negativ <strong>für</strong> den Tourismus ist die monokulturelle Anbauweise in weiten Teilen der Weinbauregionen,<br />
die zu einer gewissen Verödung der Landschaft außerhalb der Vegetationsperioden<br />
führt (Rebenwüste) (vgl. ETI 2005, S. 202). „Das Pilotprojekt <strong>„Roter</strong> Weinbergspfirsich“<br />
bietet an manchen Orten ökologische und auch neue ökonomische Perspektiven an den<br />
Hängen von <strong>Mosel</strong> und Mittelrhein“ (PRESSESTELLE DER STAATSKANZLEI 2005, S. 1). Konzepte,<br />
die bei der Marillenblüte der Wachau oder der Mandelblüte in der Vorderpfalz angewen-