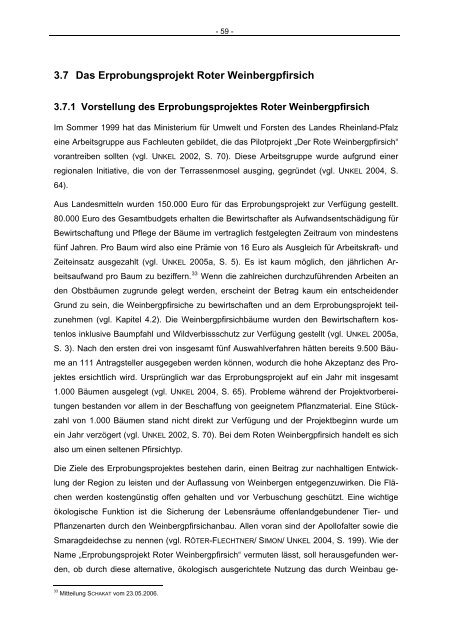Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 59 -<br />
3.7 Das Erprobungsprojekt Roter Weinbergpfirsich<br />
3.7.1 Vorstellung des Erprobungsprojektes Roter Weinbergpfirsich<br />
Im Sommer 1999 hat das Ministerium <strong>für</strong> Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz<br />
eine Arbeitsgruppe aus Fachleuten gebildet, die das Pilotprojekt „Der Rote <strong>Weinbergpfirsich“</strong><br />
vorantreiben sollten (vgl. UNKEL 2002, S. 70). Diese Arbeitsgruppe wurde aufgrund einer<br />
regionalen Initiative, die von der Terrassenmosel ausging, <strong>gegründet</strong> (vgl. UNKEL 2004, S.<br />
64).<br />
Aus Landesmitteln wurden 150.000 Euro <strong>für</strong> das Erprobungsprojekt zur Verfügung gestellt.<br />
80.000 Euro des Gesamtbudgets erhalten die Bewirtschafter als Aufwandsentschädigung <strong>für</strong><br />
Bewirtschaftung und Pflege der Bäume im vertraglich festgelegten Zeitraum von mindestens<br />
fünf Jahren. Pro Baum wird also eine Prämie von 16 Euro als Ausgleich <strong>für</strong> Arbeitskraft- und<br />
Zeiteinsatz ausgezahlt (vgl. UNKEL 2005a, S. 5). Es ist kaum möglich, den jährlichen Arbeitsaufwand<br />
pro Baum zu beziffern. 33 Wenn die zahlreichen durchzuführenden Arbeiten an<br />
den Obstbäumen zugrunde gelegt werden, erscheint der Betrag kaum ein entscheidender<br />
Grund zu sein, die Weinbergpfirsiche zu bewirtschaften und an dem Erprobungsprojekt teilzunehmen<br />
(vgl. Kapitel 4.2). Die Weinbergpfirsichbäume wurden den Bewirtschaftern kostenlos<br />
inklusive Baumpfahl und Wildverbissschutz zur Verfügung gestellt (vgl. UNKEL 2005a,<br />
S. 3). Nach den ersten drei von insgesamt fünf Auswahlverfahren hätten bereits 9.500 Bäume<br />
an 111 Antragsteller ausgegeben werden können, wodurch die hohe Akzeptanz des Projektes<br />
ersichtlich wird. Ursprünglich war das Erprobungsprojekt auf ein Jahr mit insgesamt<br />
1.000 Bäumen ausgelegt (vgl. UNKEL 2004, S. 65). Probleme während der Projektvorbereitungen<br />
bestanden vor allem in der Beschaffung von geeignetem Pflanzmaterial. Eine Stückzahl<br />
von 1.000 Bäumen stand nicht direkt zur Verfügung und der Projektbeginn wurde um<br />
ein Jahr verzögert (vgl. UNKEL 2002, S. 70). Bei dem Roten Weinbergpfirsich handelt es sich<br />
also um einen seltenen Pfirsichtyp.<br />
Die Ziele des Erprobungsprojektes bestehen darin, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung<br />
der Region zu leisten und der Auflassung von Weinbergen entgegenzuwirken. Die Flächen<br />
werden kostengünstig offen gehalten und vor Verbuschung geschützt. Eine wichtige<br />
ökologische Funktion ist die Sicherung der Lebensräume offenlandgebundener Tier- und<br />
Pflanzenarten durch den Weinbergpfirsichanbau. Allen voran sind der Apollofalter sowie die<br />
Smaragdeidechse zu nennen (vgl. RÖTER-FLECHTNER/ SIMON/ UNKEL 2004, S. 199). Wie der<br />
Name „Erprobungsprojekt Roter <strong>Weinbergpfirsich“</strong> vermuten lässt, soll herausgefunden werden,<br />
ob durch diese alternative, ökologisch ausgerichtete Nutzung das durch Weinbau ge-<br />
33 Mitteilung SCHAKAT vom 23.05.2006.