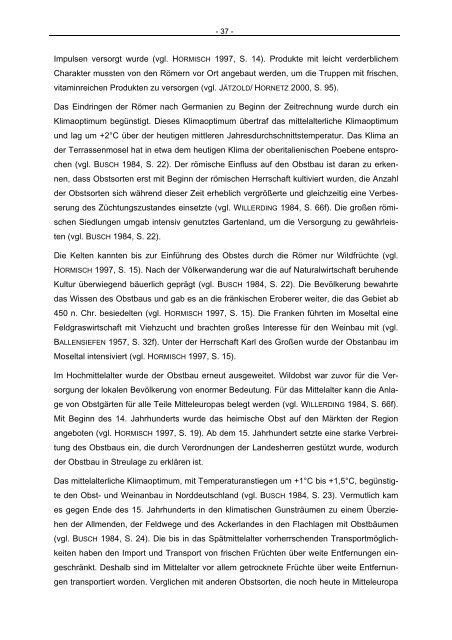Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 37 -<br />
Impulsen versorgt wurde (vgl. HORMISCH 1997, S. 14). Produkte mit leicht verderblichem<br />
Charakter mussten von den Römern vor Ort angebaut werden, um die Truppen mit frischen,<br />
vitaminreichen Produkten zu versorgen (vgl. JÄTZOLD/ HORNETZ 2000, S. 95).<br />
Das Eindringen der Römer nach Germanien zu Beginn der Zeitrechnung wurde durch ein<br />
Klimaoptimum begünstigt. Dieses Klimaoptimum übertraf das mittelalterliche Klimaoptimum<br />
und lag um +2°C über der heutigen mittleren Jahresdurchschnittstemperatur. Das Klima an<br />
der Terrassenmosel hat in etwa dem heutigen Klima der oberitalienischen Poebene entsprochen<br />
(vgl. BUSCH 1984, S. 22). Der römische Einfluss auf den Obstbau ist daran zu erkennen,<br />
dass Obstsorten erst mit Beginn der römischen Herrschaft kultiviert wurden, die Anzahl<br />
der Obstsorten sich während dieser Zeit erheblich vergrößerte und gleichzeitig eine Verbesserung<br />
des Züchtungszustandes einsetzte (vgl. WILLERDING 1984, S. 66f). Die großen römischen<br />
Siedlungen umgab intensiv genutztes Gartenland, um die Versorgung zu gewährleisten<br />
(vgl. BUSCH 1984, S. 22).<br />
Die Kelten kannten bis zur Einführung des Obstes durch die Römer nur Wildfrüchte (vgl.<br />
HORMISCH 1997, S. 15). Nach der Völkerwanderung war die auf Naturalwirtschaft beruhende<br />
Kultur überwiegend bäuerlich geprägt (vgl. BUSCH 1984, S. 22). Die Bevölkerung bewahrte<br />
das Wissen des Obstbaus und gab es an die fränkischen Eroberer weiter, die das Gebiet ab<br />
450 n. Chr. besiedelten (vgl. HORMISCH 1997, S. 15). Die Franken führten im <strong>Mosel</strong>tal eine<br />
Feldgraswirtschaft mit Viehzucht und brachten großes Interesse <strong>für</strong> den Weinbau mit (vgl.<br />
BALLENSIEFEN 1957, S. 32f). Unter der Herrschaft Karl des Großen wurde der Obstanbau im<br />
<strong>Mosel</strong>tal intensiviert (vgl. HORMISCH 1997, S. 15).<br />
Im Hochmittelalter wurde der Obstbau erneut ausgeweitet. Wildobst war zuvor <strong>für</strong> die Versorgung<br />
der lokalen Bevölkerung von enormer Bedeutung. Für das Mittelalter kann die Anlage<br />
von Obstgärten <strong>für</strong> alle Teile Mitteleuropas belegt werden (vgl. WILLERDING 1984, S. 66f).<br />
Mit Beginn des 14. Jahrhunderts wurde das heimische Obst auf den Märkten der Region<br />
angeboten (vgl. HORMISCH 1997, S. 19). Ab dem 15. Jahrhundert setzte eine starke Verbreitung<br />
des Obstbaus ein, die durch Verordnungen der Landesherren gestützt wurde, wodurch<br />
der Obstbau in Streulage zu erklären ist.<br />
Das mittelalterliche Klimaoptimum, mit Temperaturanstiegen um +1°C bis +1,5°C, begünstigte<br />
den Obst- und Weinanbau in Norddeutschland (vgl. BUSCH 1984, S. 23). Vermutlich kam<br />
es gegen Ende des 15. Jahrhunderts in den klimatischen Gunsträumen zu einem Überziehen<br />
der Allmenden, der Feldwege und des Ackerlandes in den Flachlagen mit Obstbäumen<br />
(vgl. BUSCH 1984, S. 24). Die bis in das Spätmittelalter vorherrschenden Transportmöglichkeiten<br />
haben den Import und Transport von frischen Früchten über weite Entfernungen eingeschränkt.<br />
Deshalb sind im Mittelalter vor allem getrocknete Früchte über weite Entfernungen<br />
transportiert worden. Verglichen mit anderen Obstsorten, die noch heute in Mitteleuropa