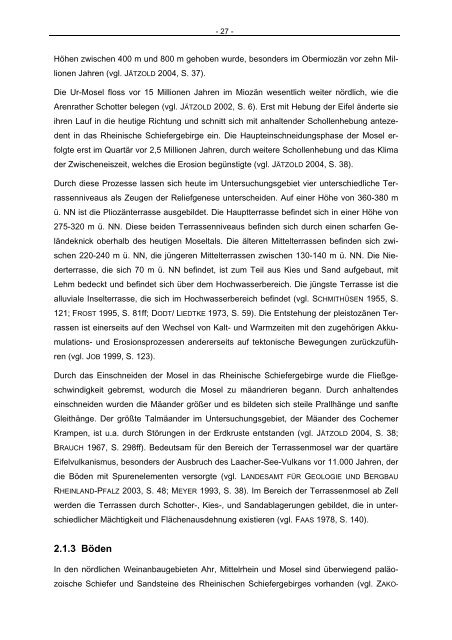Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 27 -<br />
Höhen zwischen 400 m und 800 m gehoben wurde, besonders im Obermiozän vor zehn Millionen<br />
Jahren (vgl. JÄTZOLD 2004, S. 37).<br />
Die Ur-<strong>Mosel</strong> floss vor 15 Millionen Jahren im Miozän wesentlich weiter nördlich, wie die<br />
Arenrather Schotter belegen (vgl. JÄTZOLD 2002, S. 6). Erst mit Hebung der Eifel änderte sie<br />
ihren Lauf in die heutige Richtung und schnitt sich mit anhaltender Schollenhebung antezedent<br />
in das Rheinische Schiefergebirge ein. Die Haupteinschneidungsphase der <strong>Mosel</strong> erfolgte<br />
erst im Quartär vor 2,5 Millionen Jahren, durch weitere Schollenhebung und das Klima<br />
der Zwischeneiszeit, welches die Erosion begünstigte (vgl. JÄTZOLD 2004, S. 38).<br />
Durch diese Prozesse lassen sich heute im Untersuchungsgebiet vier unterschiedliche Terrassenniveaus<br />
als Zeugen der Reliefgenese unterscheiden. Auf einer Höhe von 360-380 m<br />
ü. NN ist die Pliozänterrasse ausgebildet. Die Hauptterrasse befindet sich in einer Höhe von<br />
275-320 m ü. NN. Diese beiden Terrassenniveaus befinden sich durch einen scharfen Geländeknick<br />
oberhalb des heutigen <strong>Mosel</strong>tals. Die älteren Mittelterrassen befinden sich zwischen<br />
220-240 m ü. NN, die jüngeren Mittelterrassen zwischen 130-140 m ü. NN. Die Niederterrasse,<br />
die sich 70 m ü. NN befindet, ist zum Teil aus Kies und Sand aufgebaut, mit<br />
Lehm bedeckt und befindet sich über dem Hochwasserbereich. Die jüngste Terrasse ist die<br />
alluviale Inselterrasse, die sich im Hochwasserbereich befindet (vgl. SCHMITHÜSEN 1955, S.<br />
121; FROST 1995, S. 81ff; DODT/ LIEDTKE 1973, S. 59). Die Entstehung der pleistozänen Terrassen<br />
ist einerseits auf den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten mit den zugehörigen Akkumulations-<br />
und Erosionsprozessen andererseits auf tektonische Bewegungen zurückzuführen<br />
(vgl. JOB 1999, S. 123).<br />
Durch das Einschneiden der <strong>Mosel</strong> in das Rheinische Schiefergebirge wurde die Fließgeschwindigkeit<br />
gebremst, wodurch die <strong>Mosel</strong> zu mäandrieren begann. Durch anhaltendes<br />
einschneiden wurden die Mäander größer und es bildeten sich steile Prallhänge und sanfte<br />
Gleithänge. Der größte Talmäander im Untersuchungsgebiet, der Mäander des Cochemer<br />
Krampen, ist u.a. durch Störungen in der Erdkruste entstanden (vgl. JÄTZOLD 2004, S. 38;<br />
BRAUCH 1967, S. 298ff). Bedeutsam <strong>für</strong> den Bereich der Terrassenmosel war der quartäre<br />
Eifelvulkanismus, besonders der Ausbruch des Laacher-See-Vulkans vor 11.000 Jahren, der<br />
die Böden mit Spurenelementen versorgte (vgl. LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU<br />
RHEINLAND-PFALZ 2003, S. 48; MEYER 1993, S. 38). Im Bereich der Terrassenmosel ab Zell<br />
werden die Terrassen durch Schotter-, Kies-, und Sandablagerungen gebildet, die in unterschiedlicher<br />
Mächtigkeit und Flächenausdehnung existieren (vgl. FAAS 1978, S. 140).<br />
2.1.3 Böden<br />
In den nördlichen Weinanbaugebieten Ahr, Mittelrhein und <strong>Mosel</strong> sind überwiegend paläozoische<br />
Schiefer und Sandsteine des Rheinischen Schiefergebirges vorhanden (vgl. ZAKO-