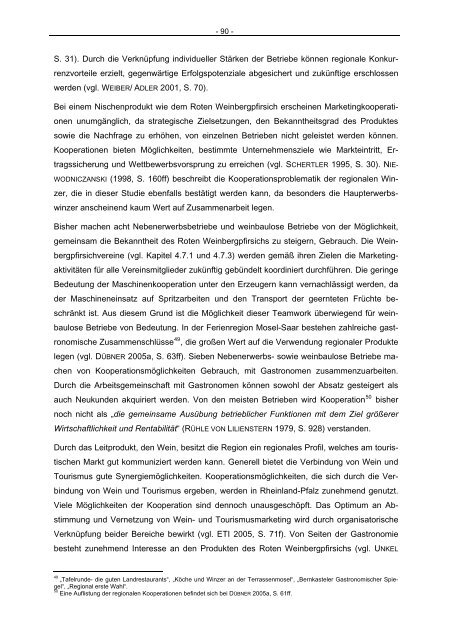Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Verein „Roter Mosel-Weinbergpfirsich“ gegründet - Landesamt für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 90 -<br />
S. 31). Durch die Verknüpfung individueller Stärken der Betriebe können regionale Konkurrenzvorteile<br />
erzielt, gegenwärtige Erfolgspotenziale abgesichert und zukünftige erschlossen<br />
werden (vgl. WEIBER/ ADLER 2001, S. 70).<br />
Bei einem Nischenprodukt wie dem Roten Weinbergpfirsich erscheinen Marketingkooperationen<br />
unumgänglich, da strategische Zielsetzungen, den Bekanntheitsgrad des Produktes<br />
sowie die Nachfrage zu erhöhen, von einzelnen Betrieben nicht geleistet werden können.<br />
Kooperationen bieten Möglichkeiten, bestimmte Unternehmensziele wie Markteintritt, Ertragssicherung<br />
und Wettbewerbsvorsprung zu erreichen (vgl. SCHERTLER 1995, S. 30). NIE-<br />
WODNICZANSKI (1998, S. 160ff) beschreibt die Kooperationsproblematik der regionalen Winzer,<br />
die in dieser Studie ebenfalls bestätigt werden kann, da besonders die Haupterwerbswinzer<br />
anscheinend kaum Wert auf Zusammenarbeit legen.<br />
Bisher machen acht Nebenerwerbsbetriebe und weinbaulose Betriebe von der Möglichkeit,<br />
gemeinsam die Bekanntheit des Roten Weinbergpfirsichs zu steigern, Gebrauch. Die Weinbergpfirsichvereine<br />
(vgl. Kapitel 4.7.1 und 4.7.3) werden gemäß ihren Zielen die Marketingaktivitäten<br />
<strong>für</strong> alle <strong>Verein</strong>smitglieder zukünftig gebündelt koordiniert durchführen. Die geringe<br />
Bedeutung der Maschinenkooperation unter den Erzeugern kann vernachlässigt werden, da<br />
der Maschineneinsatz auf Spritzarbeiten und den Transport der geernteten Früchte beschränkt<br />
ist. Aus diesem Grund ist die Möglichkeit dieser Teamwork überwiegend <strong>für</strong> weinbaulose<br />
Betriebe von Bedeutung. In der Ferienregion <strong>Mosel</strong>-Saar bestehen zahlreiche gastronomische<br />
Zusammenschlüsse 49 , die großen Wert auf die Verwendung regionaler Produkte<br />
legen (vgl. DÜBNER 2005a, S. 63ff). Sieben Nebenerwerbs- sowie weinbaulose Betriebe machen<br />
von Kooperationsmöglichkeiten Gebrauch, mit Gastronomen zusammenzuarbeiten.<br />
Durch die Arbeitsgemeinschaft mit Gastronomen können sowohl der Absatz gesteigert als<br />
auch Neukunden akquiriert werden. Von den meisten Betrieben wird Kooperation 50 bisher<br />
noch nicht als „die gemeinsame Ausübung betrieblicher Funktionen mit dem Ziel größerer<br />
Wirtschaftlichkeit und Rentabilität“ (RÜHLE VON LILIENSTERN 1979, S. 928) verstanden.<br />
Durch das Leitprodukt, den Wein, besitzt die Region ein regionales Profil, welches am touristischen<br />
Markt gut kommuniziert werden kann. Generell bietet die Verbindung von Wein und<br />
Tourismus gute Synergiemöglichkeiten. Kooperationsmöglichkeiten, die sich durch die Verbindung<br />
von Wein und Tourismus ergeben, werden in Rheinland-Pfalz zunehmend genutzt.<br />
Viele Möglichkeiten der Kooperation sind dennoch unausgeschöpft. Das Optimum an Abstimmung<br />
und Vernetzung von Wein- und Tourismusmarketing wird durch organisatorische<br />
Verknüpfung beider Bereiche bewirkt (vgl. ETI 2005, S. 71f). Von Seiten der Gastronomie<br />
besteht zunehmend Interesse an den Produkten des Roten Weinbergpfirsichs (vgl. UNKEL<br />
49<br />
„Tafelrunde- die guten Landrestaurants“, „Köche und Winzer an der Terrassenmosel“, „Bernkasteler Gastronomischer Spiegel“,<br />
„Regional erste Wahl“.<br />
50<br />
Eine Auflistung der regionalen Kooperationen befindet sich bei DÜBNER 2005a, S. 61ff.