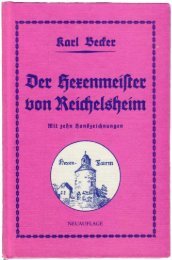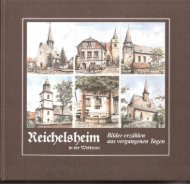Heimatbuch Reichelsheim 1992 OCR verlinkt
Reichelsheim in der goldenen Wetterau Historische Betrachtungen von Hagen Behrens Herausgeber: Magistrat der Stadt Reichelsheim Bearbeitung: Hagen Behrens Umschlaggestaltung: Jean Bourdin Gesamtherstellung: Friedrich Bischoff Druckerei GmbH, Frankfurt/Main Erschienen 1992
Reichelsheim in der goldenen Wetterau
Historische Betrachtungen von Hagen Behrens
Herausgeber: Magistrat der Stadt Reichelsheim
Bearbeitung: Hagen Behrens
Umschlaggestaltung: Jean Bourdin
Gesamtherstellung: Friedrich Bischoff Druckerei GmbH, Frankfurt/Main
Erschienen 1992
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8. b) Vom Untertan zum politischen Bürger<br />
Ein moderner Staat muß versuchen, daß die Menschen<br />
des Staatsgebietes in geordneter Form zusammenleben<br />
können. Deswegen muß es Gesetze geben, Verordnungen,<br />
von allen anerkannte Gewohnheitsregeln. Doch das<br />
bedeutet nicht „Statik“ oder Unbeweglichkeit.<br />
Die Zeit der napoleonischen Herrschaft hat Deutschland<br />
verändert. Nicht nur neue Staatsgrenzen waren gezogen<br />
worden. Die Gesetze, beeinflußt von den Ideen<br />
der Aufklärung, der Französischen Revolution und damit<br />
auch von den Ideen der Menschen- und Bürgerrechte<br />
wurden bedeutend für einen immer größer werdenden<br />
Teil der Menschen und ihren Alltag. Und dies führte zu<br />
zum Teil radikalen Änderungen in den Rechtsgrundlagen,<br />
die das Leben bestimmten:<br />
Nassau hob z. B. 1819 die Zunftordnungen auf, führte<br />
also endgültig die Gewerbefreiheit ein, was - wie auch in<br />
anderen Staaten - einer gesellschaftlichen Revolution<br />
gleichkam, wurde doch damit das aus dem Mittelalter<br />
stammende Wirtschaftssystem der regionalen Selbstversorgung<br />
abgelöst. Nun konnte sich auch in <strong>Reichelsheim</strong><br />
jeder Handwerker niederlassen, ob dies den anderen<br />
Meistern der gleichen Berufgruppe paßte oder nicht!<br />
Manch ein Geselle eröffnete seine eigene kleine Werkstatt<br />
und wurde möglicherweise zum „meisterlichen<br />
Konkurrenten“ seines ehemaligen Meisters. Und manch<br />
ein geschäftstüchtiger Meister stellte nun mehr Gesellen<br />
ein, als dies zuvor von seiner Zunft erlaubt worden wäre.<br />
Um durch die Gewerbefreiheit auch wirklich die durch<br />
die lange Kriegszeit und die damit verbundenen hohen<br />
Abgaben geschwächte Wirtschaft wieder anzukurbeln,<br />
erließ Herzog Wilhelm zum 1. Juli 1819 zusätzlich „Gesetzliche<br />
Vorschriften die Dienstverhältnisse des Gesindes<br />
und der Handwerks-Gehülfen betreffend“ (s. Archiv<br />
der Stadt <strong>Reichelsheim</strong> „Verordnungsblatt des Herzogtums<br />
Nassau“, Jg. 1819). Die Regelungen der Dienstver-<br />
hältnisse brachten vor allem den Dienstherren bzw. den<br />
Handwerksmeistern Vorteile, weniger dem Personal;<br />
doch war immerhin eine grobe einheitliche Rechtsregulierung<br />
geschaffen worden. Interessant ist, daß der<br />
Dienstvertrag zwischen Meister und Geselle bzw.<br />
Dienstherrn und Gesinde als „Mietvertrag“, das Einstandsgeld<br />
als „Mietgeld“ bezeichnet wurde. Die Höhe<br />
der „bestimmten Belohnung der Dienste“ wurde nicht<br />
per Gesetz oder allgemeiner Festlegung bestimmt (schon<br />
gar nicht durch eine Art Tarifvertrag), sondern „in freier<br />
Übereinkunft“ festgelegt. Neben der Gewerbefreiheit<br />
sollte also auch die Vertragsfreiheit im Arbeitsleben Bedeutung<br />
erhalten, was sich allerdings aus der Sicht der<br />
Arbeitnehmer nur für jene Zeiten als recht gut herausstellen<br />
sollte, in denen wirkliche Knappheit an Arbeitskräften,<br />
an Gesinde und Gesellen, bestand. Die Dauer<br />
des Dienstvertrages beim Gesinde war zudem kurz: „Bei<br />
Gesinde“, so heißt es in der genannten gesetzlichen Verordnung<br />
des Herzogs, „welches zu häuslichen Diensten<br />
gemietet ist, auf ein Vierteljahr, bei demjenigen, welches<br />
zu landwirtschaftlichen Diensten angenommen worden,<br />
auf ein ganzes Jahr erachtet. Der Anfang und das Ende<br />
der Mietzeit wird im ersten Fall auf Weihnachten,<br />
Ostern, Johannistag, im letzteren Fall auf Weihnachten<br />
angenommen.“<br />
Das Leben einer Magd, eines Knechtes oder eines Gesellen<br />
war also sozial recht ungesichert. Die „Launen“<br />
der Dienstherren bzw. der Meister konnten schnell dazu<br />
führen, daß man bald wieder auf der Straße saß. Da man<br />
jeweils ein Zeugnis seines Dienstherrn benötigte, das zudem<br />
der Ortsschultheiß zu beglaubigen hatte, war man<br />
als Gesinde oder Geselle sehr auf das ständige Wohlwollen<br />
des „Mieters“ angewiesen.<br />
Doch die „neue Zeit“ brachte nicht nur Erschwernisse<br />
für die Gesellen und das Gesinde. Auch das Handwerk<br />
108