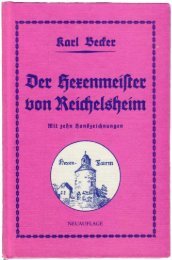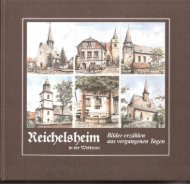Heimatbuch Reichelsheim 1992 OCR verlinkt
Reichelsheim in der goldenen Wetterau Historische Betrachtungen von Hagen Behrens Herausgeber: Magistrat der Stadt Reichelsheim Bearbeitung: Hagen Behrens Umschlaggestaltung: Jean Bourdin Gesamtherstellung: Friedrich Bischoff Druckerei GmbH, Frankfurt/Main Erschienen 1992
Reichelsheim in der goldenen Wetterau
Historische Betrachtungen von Hagen Behrens
Herausgeber: Magistrat der Stadt Reichelsheim
Bearbeitung: Hagen Behrens
Umschlaggestaltung: Jean Bourdin
Gesamtherstellung: Friedrich Bischoff Druckerei GmbH, Frankfurt/Main
Erschienen 1992
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gärten pflanzte. Sie wurde auch türkische Kirsche genannt<br />
In reichem Maße war die Zwetsche vorhanden. Die<br />
Zahl der Bäume war außerordentlich groß. Die Frucht<br />
eignete sich vorzüglich zu Kuchen. Um die Reifezeit<br />
wurde in allen Familien der schmackhafte Zwetschenkuchen<br />
gebacken.<br />
Der weitaus größte Teil der Ernte wanderte in die Kessel<br />
der Küchen, in denen oft tagelang Zwetsch enh<br />
oi n g k gekocht wurde. Aus einem Kessel schöpfte man<br />
dann 20 und mehr Steintöpfe voll Latwerg. Bekannte<br />
oder verwandte Familien trafen sich um diese Zeit oft<br />
mehrere Abende im trauten Kreise zum Zwetschenkernen.<br />
Nach Beendigung dieser Arbeit gab es dann oft noch<br />
Kaffee und Kuchen zum Abschied.<br />
Viel Arbeit erforderte schließlich das Rühren im Kessel<br />
beim Kochen des Latwerges, und manche Nacht verbrachte<br />
die Familie, sich mehrfach ablösend, beim Rühren<br />
am Hoingk-Kessel. Wenn man da nicht bei der<br />
Hand war und das Rühren versäumte, brannte der ,Sud“,<br />
so nannte man die kochende Masse, an. Die zeigte sich<br />
einmal, daß der Zwetschenbrei auf dem Boden des Kessels<br />
fest anhing und daß sich ein Brandgeruch im Raum<br />
verbreitete. Stolz füllte dann am Ende der Kochzeit die<br />
Bäuerin die Steintöpfe mit dem sämigen Mus.<br />
Die Zwetsch e n ke rn e wurden manchmal unter dem<br />
Kessel im Feuerraum verbrannt, denn sie gaben ein gutes<br />
Heizmaterial ab. Oft wurden sie auch zu allerhand<br />
Scherzzwecken verwandt, indem sich die Jugend erlaubte,<br />
die Kerne Bekannten vor das Hoftor zu schütten.<br />
(Zusätzlicher Hinweis: Es gab aber auch den Brauch, ein<br />
„Pädche“ mit den Kernen zwischen die Häuser zweier -<br />
noch „geheim“ - verliebter junger Leute zu legen, was<br />
diese meist besonders „freute“.)<br />
Kirschen gediehen in und um <strong>Reichelsheim</strong> so gut<br />
wie gar nicht, weil der Lehmboden zu fett und zu wenig<br />
steinreich war. An Hängen, die nach Westen gerichtet<br />
waren, traf man auch keine Kirschbäume und auch nicht<br />
im ebenen Gelände der Wetterau. Hingegen auf steinigen<br />
Hügeln (Assenheim) oder auf felsigen, nach Osten<br />
gerichteten Abhängen gedieh die Kirsche bestens (Rodenbach,<br />
Rosbach und Ockstadt). Aus diesen Orten kamen<br />
um die Kirschenzeit Händler und boten ihre Kirschen<br />
an.<br />
Selten traf man um die Jahrhundertwende in den Gärten<br />
Mirabellen oder Reineklauden-Bäume an.<br />
Letztere nannte die Mundart „Rennekloe“.<br />
Kernobst gab es um 1900 reichlich. An Apfelsorte<br />
n waren fast nur Hausmannssorten, die schon vor<br />
Jahrhunderten gezüchtet worden waren, vorhanden.<br />
Welche Apfelsorten kannte man um 1900 im Heimatort<br />
<strong>Reichelsheim</strong>:<br />
1. Die einzige frühe Apfelsorte, die ich kannte, waren<br />
der „Haferapfel“. Wie schon sein Name sagt, fiel die Reife<br />
in die Zeit der Haferernte.<br />
2. Späte Apfelsorten waren a) der „Karthäuser“, ein<br />
Apfel weiß bis gelb in der Farbe und ganz vorzüglich im<br />
Geschmack. Nur war er verhältnismäßig klein. b) War es<br />
der rote „Madapfel“, der sich nicht so lange aufbewahren<br />
ließ und bald mehlig wurde. c) Ihm glich an Größe und<br />
Dicke der „Weißapfel“. Beide Sorten verwendete man<br />
im Herbst zur Apfelweinbereitung. d) Wenig vertreten<br />
war der „Rheinische Bohnapfel“, der sich weniger durch<br />
seinen Geschmack als durch seine sehr lange Haltbarkeit<br />
auszeichnete.<br />
Neue Sorten waren mir nur zwei bekannt: a) die Goldparmäne.<br />
Von diesen gab es zwei Arten, eine Sommerund<br />
eine Wintergoldparmäne. Letztere war viel besser<br />
im Geschmack als die Sommerparmäne. b) In die Rubrik<br />
181