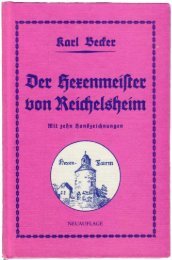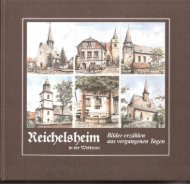Heimatbuch Reichelsheim 1992 OCR verlinkt
Reichelsheim in der goldenen Wetterau Historische Betrachtungen von Hagen Behrens Herausgeber: Magistrat der Stadt Reichelsheim Bearbeitung: Hagen Behrens Umschlaggestaltung: Jean Bourdin Gesamtherstellung: Friedrich Bischoff Druckerei GmbH, Frankfurt/Main Erschienen 1992
Reichelsheim in der goldenen Wetterau
Historische Betrachtungen von Hagen Behrens
Herausgeber: Magistrat der Stadt Reichelsheim
Bearbeitung: Hagen Behrens
Umschlaggestaltung: Jean Bourdin
Gesamtherstellung: Friedrich Bischoff Druckerei GmbH, Frankfurt/Main
Erschienen 1992
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. c) Die Kirche -für <strong>Reichelsheim</strong> das Symbol einer neuen Epoche<br />
Sollte der Bau der Landwehr rund um das Gemarkungsgebiet<br />
sowie die Ummauerung den Wohnbereich<br />
nach außen hin „erstarkt“ aussehen lassen, so wurde<br />
durch den Abschluß des Baus der Kirche im Jahre 1485<br />
auch nach innen hin ein deutliches Zeichen gesetzt.<br />
Doch schon 60 Jahre vor der angenommenen Fertigstellung<br />
der Kirche zeigte sich ein bedeutender Wandel,<br />
auf den eine Urkunde aufmerksam macht: Gilbracht Lebe<br />
(Löw) von Steinfurt, Besitzer und Lehensnehmer<br />
mehrerer Hubcn (Hufen = Anwesen) in <strong>Reichelsheim</strong><br />
und ausgestattet mit gewissen Einflußrechten auch über<br />
diesen Ort (die Herren von Steinfurt waren zu jener Zeit<br />
unter der Wetterauer Ritterschaft eine einflußreiche Familie)<br />
wirkten hier wahrscheinlich in diesen entscheidenden<br />
Jahren als Verwalter der Nassauer.<br />
Gilbracht läßt in der Urkunde vom 20. Dezember 1439<br />
folgendes festschreiben:<br />
„Ich, Gilbracht Lebe von Steynfurt bekerıne vor mich<br />
und meyn erben, in diesem brieffe, daz ich geluhen han<br />
und gegeben der kirchcn zu Richelßheyn zu ewigen tagen<br />
den gyerß czehcnden (= den Großen Zelınten) in Blafelder<br />
gericht und termenye geleigen (= in Blofelder Gemarkung<br />
gelegen) mit wißcn eyns abtcs von Folde umb<br />
Gottes und umb unser lieben Frauwen wiln und han angeseyhen<br />
notorffligkeyt eyns pferners zu Richelßheyn,<br />
daß hey sich gebruchen sal zu ewigen tagen, als vor geschriben<br />
stet; des zu eyme waren geczugniß so han ich<br />
Gilbracht Lebe meyn ingcsigel unden an disen briff gehangen.“<br />
(Entnommen: Helmut Schütz, „Ein Blick ins<br />
<strong>Reichelsheim</strong>er Pfarrarchiv“, in: „500 Jahre Kirche <strong>Reichelsheim</strong>“,<br />
S. 83).<br />
Vieles sagt diese Urkunde aus:<br />
- Die Schenkung konnte nur mit Genehmigung des<br />
Abtes von Fulda geschehen;<br />
- Die Schenkung bezieht sich auf Acker, die in der Blofelder<br />
Gemarkung liegen. Die Blofelder Bauern<br />
mußten für diese Acker den „Großen Zehnten“, also<br />
den zehnten Teil des dort Geernteten, an den <strong>Reichelsheim</strong>er<br />
Pfarrer abgeben;<br />
- Die <strong>Reichelsheim</strong>er konnten sich damit einen „eigenen“<br />
Pfarrer leisten;<br />
- Die <strong>Reichelsheim</strong>er Kirche erhielt damit Eigenständigkeit,<br />
war somit nicht weiterhin „Tochterkirche“<br />
einer anderen Kirche (Echzell);<br />
- Die Selbständigkeit <strong>Reichelsheim</strong>s von anderen Gemeinden<br />
war damit für die Offentlichleit der ganzen<br />
Region Tatsache.<br />
(Anmerkung: Nach späteren Aufzeichnungen hatte der<br />
<strong>Reichelsheim</strong>er Pfarrer „in 3 Felder und in gewissen ,Distrieten“<br />
mit dem Pfarrer zu Dauernheim den Fruchtzehnten<br />
dergestalt zu erheben, daß der <strong>Reichelsheim</strong>er<br />
Pfarrer 2/3 und der Pfarrer zu Dauernheim il/3 bezog. -<br />
Vergl. hierzu Kirchenchronik, S. 146).<br />
Über die Ordnung des Kirchwesens bis zu diesem Zeitpunkt<br />
schrieb Pfarrer Frankenfeld vor ca. 150 Jahren in<br />
der Pfarrchronik (s. S. 90 f.):<br />
„Über die Entstehung der heutigen Kirche und Pfarrei<br />
konnten von mir keine Urkunden vorgefunden werden.<br />
Den Namen Pfarreien oder Pastoreien führten im 14.<br />
Jahrhundert gewöhnlich die Mutterkirehen, mit welchen<br />
mehrere Filialen in näherer oder entfernterer Verbindung<br />
standen.. . An der Mutterkirche waren meist außer<br />
dem Pfarrherrn oder Pastor noch Amterpfarrer, Plebane<br />
genannt, oft auch Caplane angestellt. Filialorte, welche<br />
später eigene Kirchen oder Capellen gründeten, erhielten<br />
alsdann eigene Plebane oder Caplane (welchen letzteren<br />
gewöhnlich das Schulamt mit übertragen wurde),<br />
ohne daß dadurch der Filialnexus (nexus= Verbindung)<br />
30