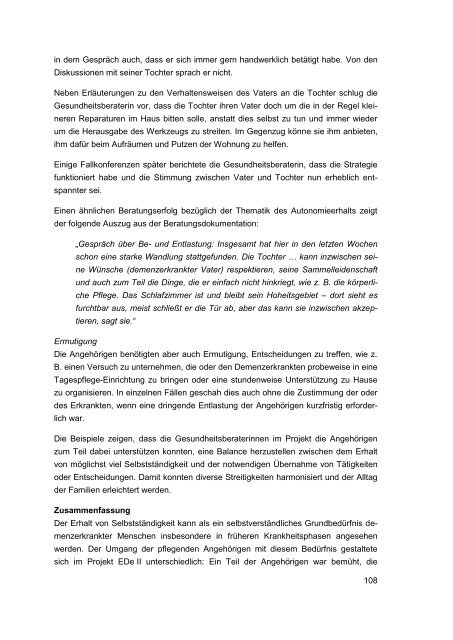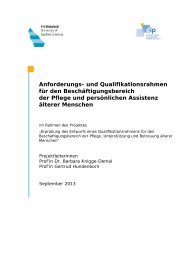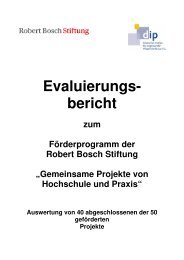EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
in dem Gespräch auch, dass er sich immer gern handwerklich betätigt habe. Von den<br />
Diskussionen mit seiner Tochter sprach er nicht.<br />
Neben Erläuterungen zu den Verhaltensweisen des Vaters an die Tochter schlug die<br />
Gesundheitsberaterin vor, dass die Tochter ihren Vater doch um die in der Regel klei-<br />
neren Reparaturen im Haus bitten solle, anstatt dies selbst zu tun und immer wieder<br />
um die Herausgabe des Werkzeugs zu streiten. Im Gegenzug könne sie ihm anbieten,<br />
ihm da<strong>für</strong> beim Aufräumen und Putzen der Wohnung zu helfen.<br />
Einige Fallkonferenzen später berichtete die Gesundheitsberaterin, dass die Strategie<br />
funktioniert habe und die Stimmung zwischen Vater und Tochter nun erheblich ent-<br />
spannter sei.<br />
Einen ähnlichen Beratungserfolg bezüglich der Thematik des Autonomieerhalts zeigt<br />
der folgende Auszug aus der Beratungsdokumentation:<br />
Ermutigung<br />
„Gespräch über Be- und Entlastung: Insgesamt hat hier in den letzten Wochen<br />
schon eine starke Wandlung stattgefunden. Die Tochter … kann inzwischen sei-<br />
ne Wünsche (demenzerkrankter Vater) respektieren, seine Sammelleidenschaft<br />
und auch zum Teil die Dinge, die er einfach nicht hinkriegt, wie z. B. die körperli-<br />
che Pflege. Das Schlafzimmer ist und bleibt sein Hoheitsgebiet – dort sieht es<br />
furchtbar aus, meist schließt er die Tür ab, aber das kann sie inzwischen akzep-<br />
tieren, sagt sie.“<br />
Die Angehörigen benötigten aber auch Ermutigung, Entscheidungen zu treffen, wie z.<br />
B. einen Versuch zu unternehmen, die oder den Demenzerkrankten probeweise in eine<br />
Tagespflege-Einrichtung zu bringen oder eine stundenweise Unterstützung zu Hause<br />
zu organisieren. In einzelnen Fällen geschah dies auch ohne die Zustimmung der oder<br />
des Erkrankten, wenn eine dringende Entlastung der Angehörigen kurzfristig erforder-<br />
lich war.<br />
Die Beispiele zeigen, dass die Gesundheitsberaterinnen im Projekt die Angehörigen<br />
zum Teil dabei unterstützen konnten, eine Balance herzustellen zwischen dem Erhalt<br />
von möglichst viel Selbstständigkeit und der notwendigen Übernahme von Tätigkeiten<br />
oder Entscheidungen. Damit konnten diverse Streitigkeiten harmonisiert und der Alltag<br />
der Familien erleichtert werden.<br />
Zusammenfassung<br />
Der Erhalt von Selbstständigkeit kann als ein selbstverständliches Grundbedürfnis de-<br />
menzerkrankter Menschen insbesondere in früheren Krankheitsphasen angesehen<br />
werden. Der Umgang der pflegenden Angehörigen mit diesem Bedürfnis gestaltete<br />
sich im Projekt <strong>EDe</strong> <strong>II</strong> unterschiedlich: Ein Teil der Angehörigen war bemüht, die<br />
108