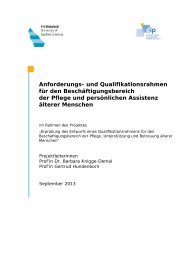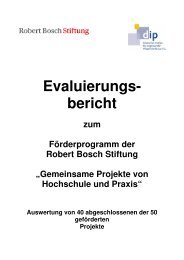EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Demenzerkrankte Personen, die angaben, dass sie unzufrieden seien, klagten häufiger<br />
über körperliche Beschwerden, kognitive Einbußen, Einsamkeit und familiäre Konflikte.<br />
Die Ressourcen- und Kompetenzorientierung der eher zufriedenen Menschen mit De-<br />
menz zeigt sich insbesondere bei den Fragen zur „Zufriedenheit mit der Gesundheitssi-<br />
tuation und sich selbst“, zur „Alltagsbewältigung“ und zur „Sicherheit im Alltag“. Ge-<br />
nannt wurden hier Aktivitäten wie Sport betreiben, Kartoffeln schälen, an der frischen<br />
Luft spazieren gehen zu können oder Fähigkeiten wie gut schlafen und essen zu kön-<br />
nen. Dabei wurde nicht nur Bezug genommen auf aktuelle Kompetenzen, sondern<br />
auch auf Leistungen aus der Vergangenheit. Ressourcen, die immer wieder im Ge-<br />
spräch erwähnt wurden, waren Hilfen und vertrauensvolle, unterstützende Beziehun-<br />
gen zu anderen.<br />
Eine weitere Strategie, die in den Auswertungen immer wieder genannt wurde und<br />
offensichtlich zur übergreifenden Lebenszufriedenheit der Erkrankten beiträgt, ist der<br />
„soziale Vergleich“ mit anderen. Demenzerkrankte Menschen, die ihre wahrgenomme-<br />
nen kognitiven Einbußen und Kompetenzverluste als normal und altersbezogen ein-<br />
ordneten, also sich mit anderen alten Menschen aus der Gegenwart und der Vergan-<br />
genheit verglichen, äußerten sich eher zufrieden. Darüber hinaus scheint der abwärts<br />
gerichtete soziale Vergleich mit anderen (z. B. „in der Tagespflege gibt es Leute, denen<br />
geht es viel schlechter“) eine Strategie zu sein, die zur Zufriedenheit beiträgt.<br />
Die Auswertungen deuten auch darauf hin, dass verlässliche Umgebungsfaktoren ein<br />
weiterer Aspekt sind, der die Zufriedenheit und die Sicherheit im Alltag positiv beein-<br />
flusst. Personen, die sich gut versorgt fühlten und/oder gute familiäre Beziehungen zur<br />
Ehefrau/Ehemann oder den Kindern hatten, äußerten sich eher zufrieden und gaben<br />
häufiger an, sich in ihrer Umgebung sicher zu fühlen. Die Sicherheit im Alltag scheint<br />
zudem auch durch das Leben in der bekannten Umgebung (Haus, Nachbarschaft)<br />
vermittelt zu werden. Die meisten Erkrankten gaben an, in ihrer derzeitigen Umgebung<br />
bleiben zu wollen. Die Antworten zeigen teilweise eine starke Verbundenheit mit der<br />
Wohnung/dem Haus. Äußerungen, die dies vermitteln sind: „Wir haben das Haus hier<br />
gekauft und aus eigener Kraft umgebaut.“ Oder: „Es ist doch schön hier.“ Der Umzug in<br />
eine neue Wohnumgebung wurde zunächst als Lebensqualität mindernd empfunden.<br />
Unzufriedenheit mit den Wohnbedingungen schien häufig gekoppelt zu sein an familiä-<br />
re Konflikte.<br />
Neben der Familie schien eine gute Nachbarschaft wesentlich zur Zufriedenheit mit<br />
den Beziehungen zu anderen Menschen beizutragen. Gute nachbarschaftliche Bezie-<br />
hungen schienen <strong>für</strong> den alltäglichen, formlosen Austausch eine wichtige Rolle zu spie-<br />
len sowie bei kleineren in unregelmäßigen Abständen entstehenden Hilfebedarfen. Die<br />
Bedeutung von Freundschaften im Allgemeinen scheint abzunehmen. Die Äußerungen<br />
der demenzerkrankten Menschen lassen den Schluss zu, dass der Kontakt abnimmt<br />
83