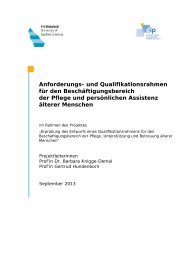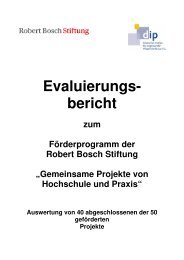EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
tem sowie Achtung und Aufrechterhaltung von Selbstbestimmung, Selbstständigkeit<br />
sowie soziale Kontakte.<br />
Die pflegenden Angehörigen erlebten die Veränderung der Demenzerkrankten in Form<br />
von zunehmenden kognitiven Einschränkungen und abnehmenden Fähigkeiten, All-<br />
tagssituationen zu bewältigen. Sie erlebten Veränderungen im Verhalten der Erkrank-<br />
ten wie zunehmenden Rückzug oder Verärgerung und Aggression. Weiterhin erlebten<br />
sie Veränderungen ihrer Beziehung zum demenzerkrankten Angehörigen, oftmals im<br />
Zusammenhang mit einem Rollenwechsel. Insbesondere die ersten Fallkonferenzen<br />
mit den Gesundheitsberaterinnen machten deutlich, dass das tägliche Erleben von<br />
Veränderungen <strong>für</strong> viele Angehörige wenig berechenbar und nur schwer verstehbar<br />
war. Die Telefoninterviews mit den Angehörigen zeigten, dass sich sehr viele von ihnen<br />
vor dem Projekt mit diesen Problemen und ihren Wahrnehmungen allein gefühlt haben.<br />
Dies wird dadurch gestützt, dass die demenzerkrankten Menschen zu einem frühen<br />
Zeitpunkt der Erkrankung ihre Einbußen anderen Familienangehörigen oder Freunden<br />
gegenüber zum Teil gut verbergen konnten und diese dann oft wenig Verständnis <strong>für</strong><br />
die Sorgen der Hauptpflegepersonen hatten (Kap. 7.2.1). „Nicht allein dazustehen“ war<br />
in den Telefoninterviews die häufigste Antwort auf die Frage „Was war <strong>für</strong> Sie das<br />
Wichtigste im Projekt?“ Viele der weiteren Ausführungen der Angehörigen machen<br />
deutlich, dass sie sich hilflos gefühlt und Angst gehabt hatten.<br />
Die Gesundheitsberaterinnen berichteten in den Fallkonferenzen regelmäßig von<br />
Ängsten und Zukunftssorgen der pflegenden Angehörigen. Diese sind u. a. im Zusam-<br />
menhang zu sehen mit der Unvorhersehbarkeit des Krankheitsverlaufs, der Nichtver-<br />
stehbarkeit der Veränderungen, aber auch mit dem Gefühl des Alleinseins mit den<br />
Problemen. Fragen wie „Wie lange kann mein Mann noch zu Hause wohnen?“, „Wie<br />
lange kann ich es noch schaffen, meine Frau zu versorgen?“, „Ich bin gesundheitlich<br />
selbst angeschlagen, wie soll alles weiter gehen?“, „Was soll aus dem Haus werden,<br />
wo soll ich wohnen, wenn mein Mann ins Heim muss?“, wurden vielfach in den Bera-<br />
tungsgesprächen gestellt.<br />
In dieser Situation, die von Angst und Zukunftssorgen und in vielen Fällen von dem<br />
Gefühl des Alleinseins geprägt war, mussten die pflegenden Angehörigen dennoch<br />
versuchen, den Alltag <strong>für</strong> und mit dem demenzerkrankten Menschen zu steuern, die<br />
Balance zu halten zwischen Ermöglichung von Selbstständigkeit und der Übernahme<br />
von Tätigkeiten oder Entscheidungen <strong>für</strong> die Demenzerkrankten. Nicht alle Angehöri-<br />
gen waren dabei in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Die Bedürfnisse der demenz-<br />
erkrankten Menschen nach Sicherheit erfordern von den Angehörigen, ihnen diese im<br />
Alltag zu geben – in einer Situation der eigenen Verunsicherung.<br />
117