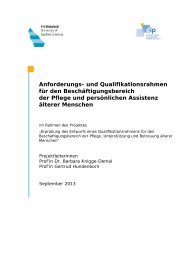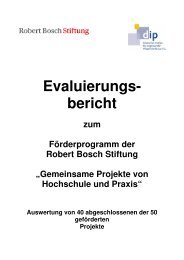EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Beratungsmethodik und Umgang mit Barrieren<br />
Die methodische Ausgestaltung des Beratungskonzeptes hat nach Einschätzung der<br />
Gesundheitsberaterinnen die Zielerreichung unterstützt und kann daher als grundsätz-<br />
lich angemessen auch <strong>für</strong> die Zielgruppe in <strong>EDe</strong> <strong>II</strong> betrachtet werden. Die im Konzept<br />
beschriebenen spezifischen Anforderungen, die sich insbesondere aus dem Einbezie-<br />
hen der demenzerkrankten Menschen, aus der noch stärker als in <strong>EDe</strong> I gewichteten<br />
Ressourcenorientierung und aus der neu hinzugekommenen Netzwerkarbeit ergeben<br />
haben, erforderten auch von erfahrenen Beraterinnen eine intensive Auseinanderset-<br />
zung mit einer neuen Beratungssituation. Unterstützend fanden während des Projekts<br />
verschiedene Schulungen statt (Kap. 5.5) sowie eine regelmäßige intensive Bearbei-<br />
tung von problematischen Beratungssituationen in den Fallkonferenzen (Kap. 5.4) und<br />
Supervisionen (Kap. 5.3.5).<br />
Vor dem Hintergrund der Zielgruppenspezifika musste auch die in <strong>EDe</strong> I ausführlich<br />
thematisierte Barrierenbearbeitung neu reflektiert werden. Im Sinne von <strong>EDe</strong> I werden<br />
unter Barrieren Einflussfaktoren verstanden, die verhindern, dass die Familien Hilfe in<br />
Anspruch nehmen, oder die die Inanspruchnahme verzögern. Die Barrieren lassen sich<br />
einteilen in Barrieren auf Systemebene, Barrieren im Hilfesystem der Leistungserbrin-<br />
ger und Barrieren auf Einzelfallebene. 162 Barrieren, die sich bestimmten Unterstüt-<br />
zungsangeboten zuordnen lassen, wurden bereits in Kapitel 6.4.2 tabellarisch darge-<br />
stellt.<br />
In einem der Workshops wurden mit den Gesundheitsberaterinnen Barrieren auf Ein-<br />
zelfallebene thematisiert: In vielen Fällen wurden Hilfen durch die demenzerkrankten<br />
Menschen selbst abgelehnt, oftmals entstand aber auch in der Beratung der Eindruck,<br />
dass die Angehörigen die Ablehnung des Erkrankten vorgaben, um die eigenen Vor-<br />
behalte nicht auszusprechen. Die Diskussion im Workshop ergab, dass sich die Vor-<br />
behalte der Angehörigen nach mehreren Beratungsgesprächen insbesondere als<br />
Angst vor Fremdbestimmung oder als Folge gewachsener Beziehungsdynamiken her-<br />
ausstellten. Im Workshop wurde herausgearbeitet, dass an diesen Stellen Grenzen in<br />
der Beratung erreicht sein können, an denen Barrieren gegenüber Hilfen akzeptiert<br />
werden müssen. Barrieren dieser Art haben ihren Ursprung oft in der Persönlichkeit<br />
des zu Beratenden und stehen im Zusammenhang mit früheren Erfahrungen. In die-<br />
sem Sinne „darf einiges in der Psyche der Angehörigen unerkannt bleiben und gehört<br />
nicht in die Beratungssituation“. 163 164 Barrieren können somit auch eine Schutzfunktion<br />
162 Emme v. d. Ahe, H.; Weidner, F.; Laag, U. (2010), S. 236<br />
163 Zitat von Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer im Workshop zum Umgang mit Barrieren am 31.01.2011.<br />
164 Mit Bezug auf Gröning, K. (2005), S. 69-76: Auch wenn die Grenzen zwischen Beratung und Therapie<br />
fließend sind, soll hier deutlich gemacht werden, dass eine „Therapeutisierung“ von Beratung unbedingt<br />
vermieden werden soll. Einerseits lassen dies die Ressourcen im SGX XI nicht zu, andererseits<br />
128