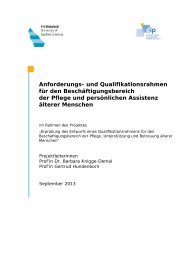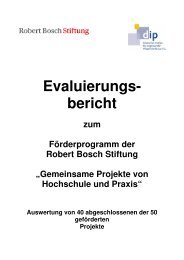EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
EDe II - Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Familien gestärkt. Es war möglich Probleme zu antizipieren, Risikofaktoren zu erfassen<br />
und aufzuzeigen, so dass sie umgehbar wurden bzw. Vorbeugung greifen konnte.<br />
Schon im Vorprojekt <strong>EDe</strong> I konnte deutlich gemacht werden, dass die „<strong>EDe</strong>-<br />
Philosophie“ dreifach belastungspräventiv wirkt, denn sie „setzt frühzeitig an, wirkt<br />
selbst entlastend und bahnt Wege zu Entlastungsmöglichkeiten.“ 173<br />
Im Projekt wurden die Pflegegutachten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausge-<br />
wertet. In der Analyse der vorliegenden Pflegegutachten 174 wurde deutlich, dass von<br />
den MDK-Gutachterinnen und -Gutachtern Empfehlungen 175 bezüglich präventiver und<br />
rehabilitativer Leistungen nur in einem geringen Umfang ausgesprochen worden sind.<br />
Dabei konnte z. B. Bohlken 176 bereits belegen, dass unter Kostengesichtspunkten eine<br />
kontinuierliche ergotherapeutische Gruppenbehandlung mit Hirnleistungstraining bei<br />
leicht- bis mittelgradigen Demenzen gegenwärtig preisgünstiger ist als eine medika-<br />
mentöse Behandlung mit Antidementiva. Auch die S3-Leitlinien der DGPPN und<br />
DGN 177 geben positive Empfehlungen bezüglich Ergotherapie, körperlicher Aktivität und<br />
Rehabilitation bei Demenz.<br />
Die Grundsystematik der sozialrechtlichen Bewältigung der Demenz im SGB XI<br />
Unstrittig ist, dass der Gesetzgeber im Jahr 2002 mit den Regelungen im Pflegeleis-<br />
tungsergänzungsgesetz einen großen Schritt hin zur leistungsrechtlichen Bewältigung<br />
der „Bedarfslage Demenz“ unternommen hat und damit einen neuen gesellschaftspoli-<br />
tischen Konsens in der sozialstaatlichen Bedeutung dieser Erkrankung geschaffen hat<br />
– auch wenn es sich zunächst um eine nur begrenzte Anerkennung der Bedarfslage<br />
handelte. Im Jahr 2008 wurde in einem doppelten Sinne nachgebessert: Es wurde eine<br />
Erweiterung der Leistungsvoraussetzungen geschaffen sowie eine Erweiterung des<br />
Leistungskatalogs und des Leistungsumfangs. Fahlbusch spricht in diesem Zusam-<br />
menhang von „der Einführung einer ´Pflegestufe Demenz´ und einem Paradigmen-<br />
wechsel in der sozialstaatlichen Bewältigung der Demenz.“ Die Autorinnen und Auto-<br />
ren des vorliegenden Berichts folgen ihm, auch wenn er zu bedenken gibt: „Eine Aner-<br />
173<br />
Emme von der Ahe, H.; Weidner, F.; Laag, U.; Isfort, M.; Meyer, S. H. (2010), S. 280.<br />
174<br />
Die vollständige Analyse der Pflegegutachten der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer ist der Anlage<br />
8 zu entnehmen.<br />
175<br />
Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V. (MDS) (2009) unter D6, S.<br />
84f: „Pflegebedürftigkeit ist regelmäßig kein unveränderbarer Zustand, sondern ein Prozess, der durch<br />
aktivierende Pflege, Maßnahmen der Krankenbehandlung, Leistungen mit präventiver und rehabilitativer<br />
Zielsetzung oder durch medizinische Rehabilitation beeinflussbar ist. Hier hat der Gutachter unter<br />
Würdigung der Ergebnisse der Pflegebegutachtung <strong>für</strong> den häuslichen und stationären Bereich Stellung<br />
zu nehmen, ob über die derzeitige Versorgungssituation hinaus (siehe Punkte 1.1 bis 1.4 „Derzeitige<br />
Versorgungs- und Betreuungssituation”, Punkt 2.1 „Pflegerelevante Aspekte der ambulanten<br />
Wohnsituation” und Punkt 2.3 „Pflegerelevante Vorgeschichte (Anamnese)” des Formulargutachtens)<br />
präventive Maßnahmen, Heilmittel als Einzelleistungen (Physikalische Therapie, Ergotherapie, Stimm-,<br />
Sprech- und Sprachtherapie, podologische Therapie) oder eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation<br />
(ambulante einschließlich mobile oder stationäre Rehabilitation) erforderlich sind.“<br />
176<br />
Bohlken, J. (2006), S. 111-119<br />
177 DGPPN; DGN (2009), S. 77-78 und S. 87-88<br />
144