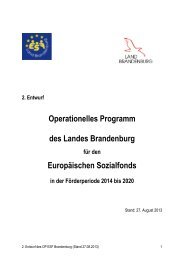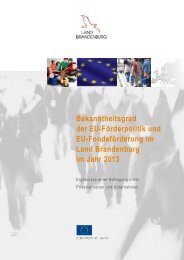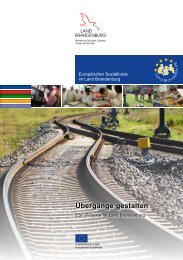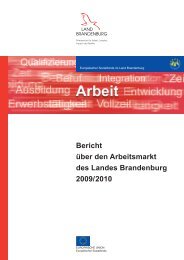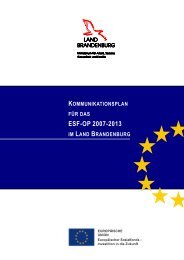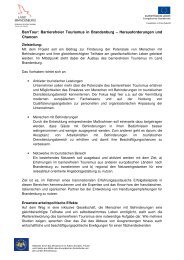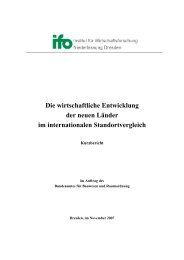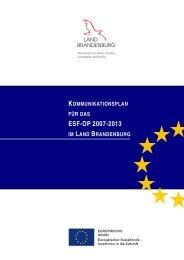Studie "Zukunftsfelder in Ostdeutschland" - ESF in Brandenburg
Studie "Zukunftsfelder in Ostdeutschland" - ESF in Brandenburg
Studie "Zukunftsfelder in Ostdeutschland" - ESF in Brandenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
können. Oftmals knüpfen diese an bereits länger vorhandene, zum Teil „historisch<br />
gewachsene“, regionale Spezialisierungen an. Beispiele s<strong>in</strong>d die optische Industrie <strong>in</strong><br />
Jena sowie die Textilherstellung im Erzgebirge. E<strong>in</strong>e Folgeuntersuchung des IWH<br />
aus dem Jahr 2007 zeigt, dass sich im Zeitraum 2000 bis 2005 die Anzahl der <strong>in</strong>no-<br />
vativen Kompetenzfelder von 80 auf 110 erhöhte. Mit +12 und +9 konnten Sachsen<br />
und Thür<strong>in</strong>gen den deutlichsten Zuwachs <strong>in</strong> Kompetenzfeldern verzeichnen (vgl. IWH<br />
2007).<br />
E<strong>in</strong> Vergleich zwischen Neuen und Alten Bundesländern bestätigt die nach wie vor<br />
zu niedrigen Beschäftigtenanteile <strong>in</strong> Branchen des Produzierenden Gewerbes. Die<br />
<strong>Studie</strong> legt weiter dar, dass die ostdeutschen Branchenschwerpunkte im Verhältnis<br />
zu Westdeutschland schwach ausgeprägt s<strong>in</strong>d und Gefahr laufen, durch das ge-<br />
samtdeutsche Raster zu fallen bzw. zu wenig beachtet zu werden. E<strong>in</strong>e stärkere<br />
räumliche Differenzierung <strong>in</strong> der Regionalpolitik, so die Erwartung des Wirtschaftsfor-<br />
schungs<strong>in</strong>stituts, kann dies verh<strong>in</strong>dern, <strong>in</strong>dem jene Strukturen zu stärken s<strong>in</strong>d, die<br />
sich als „regionale Cluster“ oder zum<strong>in</strong>dest als „potentielle regionale Cluster“ identifi-<br />
zieren lassen. Solche Clusteransätze s<strong>in</strong>d vor allem <strong>in</strong> größeren ostdeutschen Zent-<br />
ren verankert, mit e<strong>in</strong>er kritischen Masse an <strong>in</strong>novativen Unternehmen, Hochschulen<br />
und außeruniversitären Forschungse<strong>in</strong>richtungen. Die Regionen, die sich bereits auf<br />
strategische Cluster konzentrieren, liegen auch beim Wachstum vorn (vgl. PROG-<br />
NOS 2007). Sie entwickeln außerdem spill-over-Effekte für das unmittelbare Umland<br />
der Zentren. Und das ist es schließlich, was den ostdeutschen Städten bislang fehlt -<br />
die nötige Ausstrahlungskraft.<br />
Ostdeutschland kann bezüglich se<strong>in</strong>er Innovationspotentiale nicht als „monolithischer<br />
Block“ gesehen werden, sondern zeichnet sich durch e<strong>in</strong>e sehr differenzierte regio-<br />
nale Innovationsstruktur aus (vgl. PROGNOS 2007). So konzentrieren sich <strong>in</strong>novati-<br />
ve Aktivitäten neben Berl<strong>in</strong> und se<strong>in</strong>em unmittelbarem Umfeld vor allem <strong>in</strong> sächsi-<br />
schen und thür<strong>in</strong>gischen Raumordnungsregionen. Dies zeigen nicht nur die Ergeb-<br />
nisse der Untersuchungen des IWH, sondern auch e<strong>in</strong>e Reihe von Innovations<strong>in</strong>dika-<br />
toren (vgl. Abschnitt 4.1). Damit manifestiert sich ähnlich wie <strong>in</strong> Westdeutschland e<strong>in</strong><br />
historisch lang angelegtes Süd-Nord-Gefälle der Innovationskraft.<br />
35